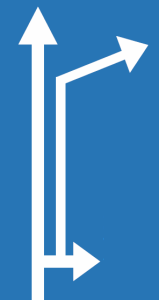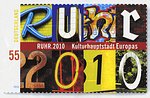Außen vor
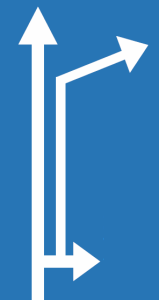
Weltmusiker und Liedermacher bei Ruhr 2010 nur in einer Nebenrolle
Von der „Eh-da“-Kultur, die sich selber trägt
4,8 Millionen Besucher in sechs Monaten – die Veranstalter von Ruhr 2010
konnten zur Halbzeit eine stolze Bilanz präsentieren. Das Image vom grauen
Ruhrpott wandelt sich stetig. Seit in den Neunzigerjahren zwischen Wesel und
Werne Industriebrachen zu Industriedenkmälern verwandelt wurden, locken Routen
der Industriekultur, wo früher Hochöfen schmauchten und Förderbänder rollten.
„Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“, diesem Motto des
Folkwang-Museum-Gründers Karl Ernst Osthaus folgen auch die Macher des
Kulturhauptstadtjahres, mit rund dreihundert Projekten, zweitausendfünfhundert
Veranstaltungen und einem Budget von 62,5 Millionen Euro vorläufiger Höhepunkt
des Strukturwandels. Welchen Platz haben Weltmusiker und Liedermacher in dem
bunten Reigen? Wie werden ihre Projekte in diesem Jahr der Kultur unterstützt?
In der Szene ist von Euphorie und Aufbruchstimmung wenig zu spüren. Das zeigten
Gespräche mit einigen ihrer Protagonisten. Eine subjektive Momentaufnahme.
TEXT: SYLVIA SYSTERMANS
|
„Ich hab’ kein Heimatland / Nein, das ist abgebrannt / Mir bleibt der
Nordstadtstrand / Bei uns hier im Revier regiert Hartz IV / Das ist
Bukowski-Land / Mein Freund heißt Bohnekamp / Mir bleibt der Bordsteinrand / Bei
uns hier im Revier.“ Boris Gott schmettert seinen Bukowski-Song gegen die
Betontristesse des Dortmunder Arbeitsamtes. Seit acht Uhr ist er unterwegs.
Erste Station war das Arbeitsamt in Unna, von dort ging es weiter Richtung
Nordwesten. Bönen, Kamen, Bergkamen, Lünen, Waltrop. Orte, die
Nicht-Ruhrgebietler am ehesten aus der Stauschau kennen. Schon zweimal zog Boris
Gott durch die Lebensadern des Ruhrgebiets. 2007 mit seiner Kneipentour: zwanzig
Kneipen in einer Nacht. 2009 mit der Pommesbudentour: zwanzig Pommesbuden in
zwanzig Städten an einem Tag. Die Hartz-IV-Tour ist der Abschluss der Trilogie.
Zwanzig Arbeitsämter in zwanzig Städten an einem Tag. Das geht nur im größten
Ballungsraum Deutschlands. Nirgendwo sonst liegen Städte so nah beieinander. Das
will Boris Gott mit seiner Trilogie erfahrbar machen.
„Die wollen Feuerwerk,
das muss ganz viel knallen
und Funken sprühen.“
(Frank Baier)
|
Aber vor allem auch die dunkle Seite der Metropolregion mit ihren 5,5 Millionen
Einwohnern soll beleuchtet werden: Leben im Schatten von Hartz IV. Im hellen
Treiben des Kulturhauptstadtjahres kommt ihm diese Seite entschieden zu kurz.
Seit zehn Jahren lebt Boris Gott in der Dortmunder Nordstadt, mitten im sozialen
Brennpunkt. Beim Kulturhauptstadtbüro hat er im Vorfeld von Ruhr 2010 einen
Antrag für seine Ruhrgebietstrilogie eingereicht. Der Antrag wurde abgelehnt.
Überhaupt seien Gelder aus dem Ruhr-2010-Topf an der Liedermacherszene völlig
vorbeigeflossen. Allerdings, räumt der Musiker ein, sei diese Szene im
Ruhrgebiet auch wenig vernetzt, sofern sie überhaupt auf professionellem Niveau
existiert. Sicher einer der Gründe, weshalb außer Stoppok, der inzwischen in
Bayern lebt, Liedermacher im offiziellen Kulturhauptstadtprogramm so gut wie
nicht vertreten sind. Dennoch zieht Boris Gott eine positive Bilanz: Im
Augenblick werde viel kommuniziert, die Region entfalte ein neues
Selbstbewusstsein und bislang ungenutzte Potenziale. Nachhaltige Effekte
verspricht er sich, weil ein Anfang gesetzt ist, sich überhaupt mit der
Kulturszene des Ruhrgebiets auseinanderzusetzen.
„Die Grenze von Bergkamen endet
an der Grenze von Bergkamen,
und was in Dortmund passiert,
kriegen Bergkamener nicht mehr mit.“
(Birgit Ellinghaus)
|
Dass die Liedermacherszene bei Ruhr 2010 quasi nicht stattfindet, ist auch das
Fazit von Ruhrpottbarde Frank Baier. Schockiert und verärgert reagierten er und
einige Mitstreiter, als sie mit ihren Projekten bei der Ruhr-Kommission
abblitzten. Etwa Ulrich Kind und sein Zeitgeist-Ensemble der
Erich-Fried-Gesamtschule Herne mit einer „Musikalischen Zeitreise vom Kohlenpott
zur Kulturhauptstadt“. Oder die Grenzgänger und Frank Baier mit ihren „Liedern
der Märzrevolution“. Mehrfach waren sie mit dem Programm im Ruhrgebiet auf Tour,
ihre CD März 1920 wurde mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik
ausgezeichnet, der „März-Rap 1920“ stand zwei Monate auf Platz eins der
Liederbestenliste: „Und dich wundert, / warum das alles so läuft, / warum sich
statt der Hoffnung / die Gleichgültigkeit häuft.“ Vermutungen, die Anträge
könnten in der Flut von dreitausend Bewerbungen untergegangen sein, weil die
Lieder zu politisch seien, bestätigten sich nicht, so Baier. „Jemand aus der
Szene war bei den Gesprächen in den Gremien dabei, und als Argument fiel,
Projekte wie die von Frank Baier bräuchte man nicht mit Fördergeldern zu
unterstützen, denn die Szene sei ja ‚eh da‘.“ Die Degradierung zur
„Eh-da“-Kultur, die sich auch ohne Unterstützung von selbst trage, verschlug
Baier die Sprache. Die einst von Karl Ernst Osthaus postulierte Folkwang-Idee
einer „Kultur für alle“, auf die sich die Veranstalter von Ruhr 2010 explizit
beziehen, bliebe bei so viel Ignoranz wohl auf der Strecke. „Wir haben gemerkt,
das ist gar nicht das, was die wollen. Die wollen Feuerwerk, das muss ganz viel
knallen und Funken sprühen. Das macht ein Grönemeyer mit seiner Revierhymne
‚Komm zur Ruhr‘ bei der Eröffnung auf Zeche Zollverein werbewirksam mit einem
Lied und bekommt dafür viel Geld, aber wir sind nicht dabei.“
... mehr im Heft
| |

|
FOLKER auf Papier
|
|---|
Dieser Artikel ist nur ein Auszug des Original-Artikel der Print-Ausgabe!
Bestelle sie Dir! Einfach das
 Schnupper-Abo!
bestellen und
drei Ausgaben preiswert testen. Ohne weitere Verpflichtung! Schnupper-Abo!
bestellen und
drei Ausgaben preiswert testen. Ohne weitere Verpflichtung!
Oder gleich das
 Abo
? Abo
?
|
|