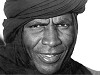 Wenn der
Wind es will, finden wir Sand aus der Sahara mitten in Europa. Besonders
gerne läßt er sich auf Autos nieder, als wolle er damit unsere
Rast- und Ruhelosigkeit anprangern: Da, wo ich herkomme, gibt es noch Zeit
zur Muße. Und Parkplätze auch. Was der Wind nicht hier
herüberträgt, ist die Musik der Menschen aus Westsahara. Die
behält der Wind gerne für sich. Weil sie so schön
ist.
Wenn der
Wind es will, finden wir Sand aus der Sahara mitten in Europa. Besonders
gerne läßt er sich auf Autos nieder, als wolle er damit unsere
Rast- und Ruhelosigkeit anprangern: Da, wo ich herkomme, gibt es noch Zeit
zur Muße. Und Parkplätze auch. Was der Wind nicht hier
herüberträgt, ist die Musik der Menschen aus Westsahara. Die
behält der Wind gerne für sich. Weil sie so schön
ist.
Von Luigi Lauer
Die Menschen, die diese schöne Musik machen, nennen sich Sahrauis. Es sind faszinierende Menschen. Die Männer mit ihren gegerbten Gesichtern, jede Falte wie der Jahresring eines Baumes. Der immerfort mahlende Sand hat ihre Haut bearbeitet, und jede Furche im Antlitz erzählt ihre Geschichte vom Leben zwischen den Dünen. Die Frauen malen sich mit Henna kunstvolle Zeichnungen auf Arme und Hände, Bilder, die an die Schnitzereien auf afrikanischen Trommeln erinnern. Dazu Ringe, Armreifen und Haarschmuck aus Perlen – das ist Anmut, im unverbrauchten Sinne des Wortes. Die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht fallen einem wieder ein. Aber waren die nicht erfunden?
 Die Sahrauis
entstammen keiner abendlichen Lagerfeuer-Phantasie. Sie sind weit wirklicher,
als es manchen lieb ist. Deshalb müssen sie in Flüchtlingslagern
leben, vertrieben vor über 20 Jahren von den Marokkanern und Mauretaniern,
nachdem Spanien sich nach mehreren UN-Resolutionen zurückziehen mußte.
Mauretanien hat sich längst aus dem Konflikt verabschiedet, der Krieg
wurde schlicht zu teuer. Marokko dagegen hat es weiterhin auf die reichen
Phosphatvorkommen der Westsahara abgesehen. Phosphat entsteht aus Phosphor,
und daraus – bittere Ironie – waren auch die Bomben gemacht, die
damals über die Sahrauis nieder gingen. Nun leben sie im Exil, 200.000
an der Zahl, auf algerischem Boden, nahe der Grenze zu ihrer Heimat, die
eingemauert und vermint ist. Dort in den Lagern, mitten in der Einöde,
machen sie das beinahe Unmögliche möglich: Sie pflegen ihre Traditionen
und erhalten ihre Kultur am Leben. Und das, obwohl sie selbst ständig
um ihr Überleben kämpfen müssen, nicht selten in der Gefahr,
zu verhungern. Ohne Hilfslieferungen sähe es noch viel schlimmer aus.
Das Völkerrecht ist zwar auf ihrer Seite, ebenso wie die Institutionen,
die für ihre Einhaltung verantwortlich zeichnen: der Internationale
Gerichtshof und die Vereinten Nationen. Nur – sie tun nichts. Dennoch
denken die Sahrauis nicht ans Aufgeben und verbringen die Zeit, die Marokko
mit seiner Hinhaltetaktik erzwingt, mit Kulturpflege. Wer dabei an
Müßiggang denkt, liegt allerdings weit daneben. Die Sahrauis wissen
sehr genau, daß eine gemeinsame Kultur auch für eine gemeinsame
Identität steht, daß sie die Menschen einigt und Kräfte
bündelt – und die haben sie bitter nötig. Kultur wird so zu
einem Teil des Überlebenskampfes, und der wird vor allem von den Frauen
getragen.
Die Sahrauis
entstammen keiner abendlichen Lagerfeuer-Phantasie. Sie sind weit wirklicher,
als es manchen lieb ist. Deshalb müssen sie in Flüchtlingslagern
leben, vertrieben vor über 20 Jahren von den Marokkanern und Mauretaniern,
nachdem Spanien sich nach mehreren UN-Resolutionen zurückziehen mußte.
Mauretanien hat sich längst aus dem Konflikt verabschiedet, der Krieg
wurde schlicht zu teuer. Marokko dagegen hat es weiterhin auf die reichen
Phosphatvorkommen der Westsahara abgesehen. Phosphat entsteht aus Phosphor,
und daraus – bittere Ironie – waren auch die Bomben gemacht, die
damals über die Sahrauis nieder gingen. Nun leben sie im Exil, 200.000
an der Zahl, auf algerischem Boden, nahe der Grenze zu ihrer Heimat, die
eingemauert und vermint ist. Dort in den Lagern, mitten in der Einöde,
machen sie das beinahe Unmögliche möglich: Sie pflegen ihre Traditionen
und erhalten ihre Kultur am Leben. Und das, obwohl sie selbst ständig
um ihr Überleben kämpfen müssen, nicht selten in der Gefahr,
zu verhungern. Ohne Hilfslieferungen sähe es noch viel schlimmer aus.
Das Völkerrecht ist zwar auf ihrer Seite, ebenso wie die Institutionen,
die für ihre Einhaltung verantwortlich zeichnen: der Internationale
Gerichtshof und die Vereinten Nationen. Nur – sie tun nichts. Dennoch
denken die Sahrauis nicht ans Aufgeben und verbringen die Zeit, die Marokko
mit seiner Hinhaltetaktik erzwingt, mit Kulturpflege. Wer dabei an
Müßiggang denkt, liegt allerdings weit daneben. Die Sahrauis wissen
sehr genau, daß eine gemeinsame Kultur auch für eine gemeinsame
Identität steht, daß sie die Menschen einigt und Kräfte
bündelt – und die haben sie bitter nötig. Kultur wird so zu
einem Teil des Überlebenskampfes, und der wird vor allem von den Frauen
getragen.
Was Wunder, daß die Musik der Sahrauis
aus jeder Pore Schweiß und Blut absondert, daß sie nach Angst,
Entbehrungen, Erniedrigungen und dem Widerstand dagegen klingt. Oder kurz:
nach Blues. Wenn, wie viele afro-amerikanische Bluesmusiker sagen, den Blues
nur spielen kann, wer ihn auch hat, dann ist dieses Volk prädestiniert
für ohrenbetäubende Schwermut. Natürlich dominiert der
Freiheitskampf die Texte, der Verlust der Heimat, das Ende der
»Reisefreiheit«, die ein Nomadenvolk naturgemäß besonders
trifft. Aber auch der unbedingte Wille zum Sieg ist Gegenstand vieler Lieder,
verstanden als Feststellung wie Ansporn. All das zeigt, wie sehr das Exil
die Sahrauis belastet, deren Lieder sonst lyrische Kunstwerke sind, dominiert
von den großen Themen Liebe und Religion. Selbst Alltagsthemen bekommen
einen anderen Stellenwert, hat sich das »Alltägliche« doch
in kurzer Zeit dramatisch verändert. Ein wenig fühlt man sich
tatsächlich an ein kleines gallisches Dorf erinnert, das beharrlich
der römischen Übermacht trotzt. Nur, daß hier niemand Troubadix
verprügelt.
 Vielleicht mehr noch als im Mali-Blues eines
Ali Farka Toure bringen die Sahrauis mit einfachen, sparsamen Mitteln eine
Stimmung zustande, die einen geradezu erschauern läßt. Die
Lebensfreude und der Frohsinn blitzen nur gelegentlich durch. Wenn hier gute
Laune hörbar wird, dann hinter vorgehaltener Hand. Nicht, daß
diese Menschen zum Lachen in den Keller gingen, keineswegs. Aber sie lachen
durch den Schleier ihrer Erfahrungen. An die Musik der Sahrauis zu gelangen,
war bis vor kurzem kaum möglich. Obwohl seit 1991 jährlich ein
Kulturfestival stattfindet, das als Wettstreit zwischen den einzelnen
Flüchtlingslagern ausgeführt wird, ist doch wenig veröffentlicht
worden. Es gab, 1982, eine von dem Spanier Manuel Dominguez herausgegebene
Platte, betitelt »Polisario Vencerá«, »Polisario wird
siegen«. Die »Frente Polisario«, das ist die Partei der Sahrauis,
gleichzeitig auch Exilregierung und Militärrat. Das Album gibt es jetzt
wieder – zusammen mit zwei weiteren CDs in einem großzügig
angelegten Set. Herausgegeben hat es wiederum Manuel Dominguez, inzwischen
Chef der bekannten Weltmusik-Schmiede NubeNegra. Er hat sich die Sache etwas
kosten lassen, allein das ehrt ihn. Zwei Wochen war er mit einem kleinen
Team und empfindlichster Ausrüstung unterwegs, um in teils abenteuerlicher
Manier Klang und Atmosphäre der Musik einzufangen, Gespräche zu
führen und Kenntnisse zu sammeln.
Vielleicht mehr noch als im Mali-Blues eines
Ali Farka Toure bringen die Sahrauis mit einfachen, sparsamen Mitteln eine
Stimmung zustande, die einen geradezu erschauern läßt. Die
Lebensfreude und der Frohsinn blitzen nur gelegentlich durch. Wenn hier gute
Laune hörbar wird, dann hinter vorgehaltener Hand. Nicht, daß
diese Menschen zum Lachen in den Keller gingen, keineswegs. Aber sie lachen
durch den Schleier ihrer Erfahrungen. An die Musik der Sahrauis zu gelangen,
war bis vor kurzem kaum möglich. Obwohl seit 1991 jährlich ein
Kulturfestival stattfindet, das als Wettstreit zwischen den einzelnen
Flüchtlingslagern ausgeführt wird, ist doch wenig veröffentlicht
worden. Es gab, 1982, eine von dem Spanier Manuel Dominguez herausgegebene
Platte, betitelt »Polisario Vencerá«, »Polisario wird
siegen«. Die »Frente Polisario«, das ist die Partei der Sahrauis,
gleichzeitig auch Exilregierung und Militärrat. Das Album gibt es jetzt
wieder – zusammen mit zwei weiteren CDs in einem großzügig
angelegten Set. Herausgegeben hat es wiederum Manuel Dominguez, inzwischen
Chef der bekannten Weltmusik-Schmiede NubeNegra. Er hat sich die Sache etwas
kosten lassen, allein das ehrt ihn. Zwei Wochen war er mit einem kleinen
Team und empfindlichster Ausrüstung unterwegs, um in teils abenteuerlicher
Manier Klang und Atmosphäre der Musik einzufangen, Gespräche zu
führen und Kenntnisse zu sammeln.
Sahrauis – Die Musik der Westsahara (NubeNegra/Intuition) 3 CDs in einer Box, Gesamtlaufzeit (46 Tracks) 2 Std. 46 Min.; Booklet Deutsch/Englisch, 120 Seiten. Preis: 49,90DM. Exklusiv bei Zweitausendeins.
|
|
|
|
|
Mehr über die Sahauris im Folker! 2/99