|
Auswahldiskografie: Guitar Town (MCA, 1986) Train A Comin’ (Winter Harvest, 1995) El Corazón (E-Squared/Warner, 1997) The Mountain (mit The Del McCoury Band; E-Squared, 1999) Jerusalem (E-Squared/Artemis, 2002) The Revolution Starts ... Now (E-Squared/Artemis, 2004) Washington Square Serenade (Blue Rose/New West, 2007) Steve Earle unterwegs (mit Special Guest Allison Moorer): 31.01.08: Amsterdam (NL), Paradiso 01.02.08: Rijssen (NL), Zaal Lucky 02.02.08: Gent (B), Hadelsbeur 04.02.08: Paris (F), Le Java 05.02.08: Paris (F), Le Java 07.02.08: Hamburg, Fabrik 08.02.08: Berlin, C-Club 09.02.08: Ludwigsburg, Scala 10.02.08: Darmstadt, Centralstation |
„Dort, an der Ecke von West 4th Street und
Mercer, war einmal Gerde’s Folk City. Wo Dylan seinen ersten Auftritt hatte.
Und da, in der MacDougal Street 110, wo heute ein Schönheitssalon ist, war
früher einmal Izzy Young mit seinem Folklore Center zu Hause.“ Fachkundig
führt Steve Earle seinen Besucher zu geschichtsträchtigen Plätzen im New
Yorker Künstlerviertel Greenwich Village. Der in Virginia geborene und in
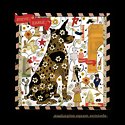 San Antonio aufgewachsene Singer/Songwriter erweist sich als Historiker mit
großem Wissen über die frühe Folkszene der Sechziger in New York. Dabei lebt
der 52-Jährige erst seit knapp zwei Jahren im West Village. Ganz in der Nähe
der Straße, wo das berühmte Coverfoto von The Freewheelin’ Bob Dylan
geschossen wurde. Und Dylans darauf abgebildete damalige Freundin, Suze
Rotolo, wohnt noch immer in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. „Hier
wurde erfunden, was ich mache“, sagt Steve Earle. „Es konnte nur passieren,
weil Folksänger, Musikologen und Schriftsteller hier gemeinsam im Umkreis
weniger Straßenblöcke lebten. Ohne diese Szene hätte aus Rock ’n’ Roll keine
Literatur werden können. Er wäre nur Popmusik geblieben.“ Gemeinsam mit
seiner Frau, der Sängerin Allison Moorer, arbeitet Earle an einer eigenen
Stadtführung durch die Musikkulturgeschichte des Village. Wer nicht so lange
warten will, kann sich auf einer DVD einen dreißigminütigen Spaziergang
anschauen, bei dem der Musiker im Gespräch mit Mark Jacobson vom New
York Magazine seine Kenntnisse über seine neue Nachbarschaft unter
Beweis stellt. Die DVD gehört zur Special-Deluxe-Ausgabe von Steve Earles
neuer CD Washington Square Serenade, mit der er im Februar auch in
Deutschland auf Tournee ist.
San Antonio aufgewachsene Singer/Songwriter erweist sich als Historiker mit
großem Wissen über die frühe Folkszene der Sechziger in New York. Dabei lebt
der 52-Jährige erst seit knapp zwei Jahren im West Village. Ganz in der Nähe
der Straße, wo das berühmte Coverfoto von The Freewheelin’ Bob Dylan
geschossen wurde. Und Dylans darauf abgebildete damalige Freundin, Suze
Rotolo, wohnt noch immer in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. „Hier
wurde erfunden, was ich mache“, sagt Steve Earle. „Es konnte nur passieren,
weil Folksänger, Musikologen und Schriftsteller hier gemeinsam im Umkreis
weniger Straßenblöcke lebten. Ohne diese Szene hätte aus Rock ’n’ Roll keine
Literatur werden können. Er wäre nur Popmusik geblieben.“ Gemeinsam mit
seiner Frau, der Sängerin Allison Moorer, arbeitet Earle an einer eigenen
Stadtführung durch die Musikkulturgeschichte des Village. Wer nicht so lange
warten will, kann sich auf einer DVD einen dreißigminütigen Spaziergang
anschauen, bei dem der Musiker im Gespräch mit Mark Jacobson vom New
York Magazine seine Kenntnisse über seine neue Nachbarschaft unter
Beweis stellt. Die DVD gehört zur Special-Deluxe-Ausgabe von Steve Earles
neuer CD Washington Square Serenade, mit der er im Februar auch in
Deutschland auf Tournee ist.
Von Michael Kleff
Über ein Jahrzehnt lang hatten die meisten Geschichten über Steve Earle
mit seinen dunklen Seiten zu tun. Damit, dass seine Alkohol- und
Heroinabhängigkeit nicht nur mehrere Ehen zerstörte, sondern fast auch sein
 Leben. Das änderte sich, nachdem er vier Monate einer einjährigen
Gefängnisstrafe wegen Drogenmissbrauchs abgesessen hatte und sein Leben
grundlegend umkrempelte. „Mittlerweile habe ich nüchtern schon mehr Platten
aufgenommen als früher, als ich auf Drogen war“, sagt er. Earles 1986
erschienenem Debütalbum Guitar Town bescheinigte der Rolling
Stone, „sein Sound verdanke Keith Richards mehr als Chet Atkins.“
Beeinflusst von Blues, Folk, aber auch von Countrymusik, gehörten zu seinen
Vorbildern neben Woody Guthrie u. a. Townes Van Zandt und John Fogerty von
Creedence Clearwater Revival.
Leben. Das änderte sich, nachdem er vier Monate einer einjährigen
Gefängnisstrafe wegen Drogenmissbrauchs abgesessen hatte und sein Leben
grundlegend umkrempelte. „Mittlerweile habe ich nüchtern schon mehr Platten
aufgenommen als früher, als ich auf Drogen war“, sagt er. Earles 1986
erschienenem Debütalbum Guitar Town bescheinigte der Rolling
Stone, „sein Sound verdanke Keith Richards mehr als Chet Atkins.“
Beeinflusst von Blues, Folk, aber auch von Countrymusik, gehörten zu seinen
Vorbildern neben Woody Guthrie u. a. Townes Van Zandt und John Fogerty von
Creedence Clearwater Revival.
|
„Hier wurde erfunden, was ich mache. Es |
Von Anfang an war der in einem liberalen Elternhaus aufgewachsene Künstler politisch aktiv. 1997 beschwor er in „Christmas In Washington“ die Geister von Woody Guthrie und Jesus. Man brauche sie heute mehr denn je, um sich der korrupten Politiker zu entledigen. Und nach einem Ausflug in die Welt des Bluegrass zwei Jahre später mit der Del McCoury Band auf The Mountain brachte Earle im Jahr 2000 seine Ablehnung der Todestrafe in „Over Yonder (Jonathan’s Song)“ zum Ausdruck: einem Lied über einen zum Tode verurteilten Strafgefangenen, dessen Hinrichtung er als Zeuge beiwohnte. Das Thema beschäftigte ihn auch in dem Bühnenstück Karla, das er über Karla Faye Tucker schrieb, die erste seit dem Bürgerkrieg in Texas hingerichtete Frau.
Mit seinem nächsten Album Jerusalem sorgte der Singer/Songwriter 2002 dann für einen Sturm der Entrüstung. Wegen seines Songs über den amerikanischen Talibankämpfer John Walker Lindh wurde ihm Landesverrat vorgeworfen. Dabei hatte Earle nur nachzuvollziehen versucht, warum ein junger Amerikaner - in diesem Fall der verurteilte John Walker Lindh - sich den Taliban anschließen konnte. Der Musiker erhebt in seinen Songs keinen moralischen Zeigefinger. Stattdessen lässt er „Average Joe“, den Bürger von nebenan zu Wort kommen, beschreibt gesellschaftliche Missstände aus dessen Perspektive. „Ich beschreibe in meinen politischen Songs, wie Politik das Leben der Menschen beeinflusst. Das habe ich immer so gemacht. Angesichts der angespannten aktuellen politischen Lage schreibe ich heute mehr solche Sachen als früher. Musik kann Mitgefühl besser als jede andere Kunstform vermitteln. Den Menschen wird versichert, nicht allein zu sein.“ Dieser Ansatz findet sich auch auf der 2004 veröffentlichten CD The Revolution Starts ... Now, für die Earle einen Grammy bekam. Fast alle Songs darauf sind geprägt von der Wut auf einen Präsidenten und seine Regierung, die vor allem Menschen aus den unteren sozialen Schichten - wie im Krieg gegen den Irak - dazu missbrauchen, für sie die schmutzige Arbeit zu erledigen.
|
|
|
|
|
|
Interesse? Dann brauchst Du die
Zeitschrift! |
Mehr über Steve Earle
|