| www.deutscher-musikrat.de |
Im November vergangenen Jahres lud der Deutsche Musikrat in Berlin zur Konferenz „Musikland Deutschland – Wie viel kulturellen Dialog wollen wir?“. Absicht war, mit Experten aus Kultur, Politik und Wissenschaft wie Michel Friedman, Cem Özdemir oder Martin Greve die Frage zu diskutieren, welche Rolle Musik und Musikerziehung spielen können, um den interkulturellen Dialog zu fördern und somit einen Beitrag zur Integration zu leisten. Die frohe Botschaft unterm Strich der Veranstaltung ist vor allem, dass der Musikrat selbst mit der Tagung einen ersten nennenswerten Gehversuch in Richtung interkultureller Öffnung unternommen hat, was im Umfeld dieses zweitgrößten Verbandes Deutschlands eine längst überfällige Signalwirkung bedeuten könnte.
Von Sabine Froese
Der 1953 in Bonn gegründete Deutsche Musikrat will als Lobbyist für die
Musik zur Weiterentwicklung der Musikkultur in Deutschland beitragen – wobei
er förderungswürdige Musikbereiche nach seinen eigenen Vorstellungen
eingrenzt, Salsa etwa oder die Pflege des Spiels auf der Djembe gehören
nicht dazu. Seine Lobbyarbeit versieht der Verband zum Beispiel mithilfe von
Förderprogrammen wie dem Wettbewerb „Jugend musiziert“, Kammermusikkursen
oder der CD-Reihe Edition Zeitgenössischer Musik. Der Musikrat setzt sich
aus 91 länderübergreifenden Fachorganisationen, 16 Landesmusikräten sowie
Ehren- und Einzelmitgliedern zusammen – insgesamt repräsentiert er nach
 eigenen Angaben über acht Millionen Menschen.
eigenen Angaben über acht Millionen Menschen.
Wie gut interkultureller Dialog ohne Worte funktionieren kann, zeigten gleich zu Beginn der Tagung zwei Musiker höchst unterschiedlicher Traditionen: Saxophon und chinesische Mundorgel harmonierten bestens. Ungleich schwieriger dann das Zusammenspiel der Meinungen: Themen wie „Interkulturelle Dialoge in Musikprojekten“ oder „Deutschland und der Islam: Schmelztiegel Berlin“ wurden auf den Podien kontrovers diskutiert. Dabei kristallisierte sich heraus, wie wichtig die Stärkung der eigenen kulturellen Identität für den interkulturellen Dialog ist und dass die Förderung des interkulturellen Dialogs mit Hilfe von Musik Geld kostet. Wer diesen Dialog und die Begegnung suche, damit etwa jedes Kind Zugang zu musikalischer Bildung bekommt oder Kultur- und Bildungseinrichtungen sich interkulturell ausrichten können, müsse auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
Um die Aufsplitterung der Gesellschaft in Teilkulturen aufzuhalten, müsse die Politik in Orte des interkulturellen Dialogs investieren. Auch die Bedeutung hierbei der Sprachkompetenz und des Laienmusizierens kamen zur Sprache. An die Medien ging der Appell, sich ihrer Verantwortung für den Dialog bewusster zu werden. Am Ende der Tagung wurden erfolgreiche Modelle der interkulturellen Begegnung im Musikbereich vorgestellt: die Werkstatt der Kulturen in Berlin mit ihrem „Karneval der Kulturen“; das alle zwei Jahre im Allgäu stattfindende Festival Musica Sacra International, bei dem Musiker der großen Weltreligionen auftreten und sich austauschen; die Einführung der Instrumentenkategorie Langhalslaute Baglama beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Berlin und Nordrhein-Westfalen; die Zusammenarbeit einer Musikschule im Bereich der Kinderchor- und Theaterarbeit mit dem Bagamoyo College of Arts in Tansania; eine Berliner Samulnorigruppe, die aus koreanischen, deutsch-koreanischen und deutschen Kindern besteht.
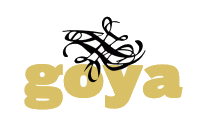
|
|
|
Diverse, Goya 1 (ESS.A.Y Recordings, 2005) |
Was tun, wenn man die Idee für einen Club hat, ein baulich interessantes, dazu geschichtsträchtiges Gebäude angeboten bekommt, nicht kleckern, sondern klotzen will - aber der Lottogewinn blieb bisher aus? Dass über die Ausgabe von Anteilsscheinen in kurzer Zeit viel Geld generiert werden kann, haben schon viele andere vorgemacht. Doch mit seiner Idee, Aktien zur Finanzierung eines Clubs zu verkaufen, ist dem Berliner Gastronom Peter Glückstein eine Weltpremiere gelungen. Jetzt muss nur noch das Publikum mitspielen.
Von Sabine Froese
Goya heißt der nicht börsennotierte neue Partytreffpunkt. Er wurde Anfang
Dezember letzen Jahres eröffnet, und zwar wegen des großen Andrangs,
 speziell auch der Medien, gleich an drei aufeinander folgenden Abenden mit
jeweils identischem Abendprogramm. Für die „Vermählung von Cocktail und
Tanz“ hat sich der Club ein altehrwürdiges Domizil gesucht, mitten im alten
Berliner Westen, im ehemaligen Metropol am Nollendorfplatz, wo neben David
Bowie und Iggy Pop auch jeder andere auftrat und feierte, der in der Stadt
und der Popmusik der 70er des letzten Jahrhunderts Rang und Namen hatte.
1906 im wilhelminischen Stil gebaut, wurde der Bau bald als Neues deutsches
Schauspielhaus fester Bestandteil der Berliner Kulturszene: Claire Waldorff
sang dort, Isadora Duncan trat mit Nackttänzen auf, der Regisseur Erwin
Piscator inszenierte sein politisches Theater. Nach dem Zweiten Weltkrieg
war das Gebäude Kino, Veranstaltungsort für Konzerte, Diskothek, und stand
zuletzt mehrere Jahre leer.
speziell auch der Medien, gleich an drei aufeinander folgenden Abenden mit
jeweils identischem Abendprogramm. Für die „Vermählung von Cocktail und
Tanz“ hat sich der Club ein altehrwürdiges Domizil gesucht, mitten im alten
Berliner Westen, im ehemaligen Metropol am Nollendorfplatz, wo neben David
Bowie und Iggy Pop auch jeder andere auftrat und feierte, der in der Stadt
und der Popmusik der 70er des letzten Jahrhunderts Rang und Namen hatte.
1906 im wilhelminischen Stil gebaut, wurde der Bau bald als Neues deutsches
Schauspielhaus fester Bestandteil der Berliner Kulturszene: Claire Waldorff
sang dort, Isadora Duncan trat mit Nackttänzen auf, der Regisseur Erwin
Piscator inszenierte sein politisches Theater. Nach dem Zweiten Weltkrieg
war das Gebäude Kino, Veranstaltungsort für Konzerte, Diskothek, und stand
zuletzt mehrere Jahre leer.
Nun ist aus dem vielseitigen Musentempel wieder ein Tanztempel geworden,
der sich mit Bars und Restauration als Ort zum Ausgehen „für Erwachsene“
definiert - hier sollen sich vor allem über 30-Jährige wohl fühlen, die
Essen, Drinks und Musik auf hohem Niveau und in edlem Ambiente zu schätzen
wissen. Für den erforderlichen Umbau konnte der Architekt Hans Kollhoff
gewonnen werden, der in Berlin auch für das DaimlerChrysler-Hochhaus am
Potsdamer Platz verantwortlich zeichnet. Über zehn Millionen Euro betrug die
Investitionssumme, von der nur 20 Prozent über Darlehen, Leasing und
Zuschüsse finanziert wurden, 80 Prozent dagegen über den Verkauf von
Anteilsscheinen: In Paketen zu knapp 4.000 und 2.000 Euro wurden Goya-Aktien
ausgegeben, die nun ihren Besitzern lebenslangen freien Eintritt sichern
 sowie das Recht, bis zu zwei Begleiter in ihren Club mitzubringen. Ist das
Konzept erfolgreich, wird eine Dividende ausgeschüttet.
sowie das Recht, bis zu zwei Begleiter in ihren Club mitzubringen. Ist das
Konzept erfolgreich, wird eine Dividende ausgeschüttet.
Zu den Aktionären gehören auch eine Reihe Promis wie Schauspieler Rolf Zacher, Bäckermeister Heiner Kamps, Bürgermeister Klaus Wowereit, Sänger und Koraspieler Mory Kanté, der Filmproduzent Artur Brauner, der Maler Markus Lüpertz, Singer/Songwriter Lokua Kanza oder der Jazzer Till Brönner. Allerdings, wie man hört, nicht unbedingt auf eigene Kosten - konfrontiert mit dem Gerücht, einige der prominenten Zugpferde hätten sich gar nicht aktiv finanziell engagiert, sondern Aktien zu Sonderkonditionen und als Gegenleistung für die Werbung mit ihrem guten Namen erhalten, reagiert die Goya-Pressestelle reserviert: Aktionäre seien Aktionäre, und Aktien würden nicht verschenkt. Im Übrigen gebe man über den Umfang des erworbenen Aktienpakets selbstverständlich keine Auskunft.
Entstanden ist in knapp 14-monatiger Umbauzeit ein vornehm-schlicht wirkender Raum, der 13 Meter hoch ist und bis zu 1.500 Besucher fasst. Von der Decke hängen 13 Kronleuchter aus farblosem Muranoglas, die mit echten Kerzen bestückt sind, und die Tanzfläche ist eingerahmt von Säulen, die sich bis zur Decke hochziehen. Sie tragen zwei umlaufende Emporen, deren obere den Aktionären und ihren Gästen vorbehalten ist. Zahlreiche gastronomische Inseln sind auf die verschiedenen Ebenen verteilt. Donnerstags, freitags und samstags öffnet das Goya ab 18.00 Uhr seine Pforten - bis 22.00 Uhr bei freiem Eintritt, danach lassen die ausschließlich weiblichen Türsteher gegen zehn Euro jeden herein, der nicht wie ein Störenfried aussieht. Um 20.00 Uhr wird bis zu 180 Gästen an langen Tafeln und bei Livemusik ein dreigängiges baskisches Menü für 35 Euro serviert. Zwei Stunden später, pünktlich um 22.00 Uhr, werden die Kronleuchter hochgezogen, innerhalb weniger Minuten alle Tische und Bänke abgeräumt und die Tanzfläche eröffnet. Von Sonntag bis Mittwoch kann das Goya gemietet werden.
|
|
|
|
|
|
Interesse? Dann brauchst Du die
Zeitschrift! |
Mehr über beide Themen
|