|
Kontakte:
Stiller Has:
Tinu Heiniger:
Dänu Brüggemann:
Berner Troubadours: |
Das Schweizer Lied existiert. Das beweist die "Liederbestenliste", die regelmäßig Schweizer Mundartlieder auf Spitzenpositionen führt. Der Grund, dass der größte Teil dieser Lieder aus dem Bernbiet stammt, hat einen Namen: Mani Matter. Der Übervater des Berner Mundartliedes hatte Dialektlieder einst salonfähig gemacht.
Von Martin Steiner
Eines muss ich vorausschicken. Möglicherweise bin ich gar nicht legitimiert,
über Berner Liedermacher zu schreiben. Ich bin nämlich Zürcher.
Unsere Mundart gilt als breit,
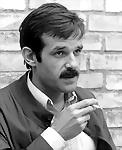 großkotzig
und vulgär. Abgesehen davon fühlen wir uns eher verwandt mit London
oder New York; die Provinz liegt uns zu weit weg. Zürcher Bands singen
im Allgemeinen Englisch, denn wer seine Zürcher Mundart im Kulturbereich
ernsthaft einsetzen möchte, wird selten ernst genommen. Liedermacher
anderer Kantone machen sich überdies noch lustig über uns: wie
etwa der Thurgauer Werner Widmer, der seinen Blues Max in breitestem
Züri-Slang erzählen lässt. Sein Max bedient exakt das Klischee
des Zürchers: Er ist laut, Dauerredner, weiß alles besser und
ist nie um eine Antwort verlegen.
großkotzig
und vulgär. Abgesehen davon fühlen wir uns eher verwandt mit London
oder New York; die Provinz liegt uns zu weit weg. Zürcher Bands singen
im Allgemeinen Englisch, denn wer seine Zürcher Mundart im Kulturbereich
ernsthaft einsetzen möchte, wird selten ernst genommen. Liedermacher
anderer Kantone machen sich überdies noch lustig über uns: wie
etwa der Thurgauer Werner Widmer, der seinen Blues Max in breitestem
Züri-Slang erzählen lässt. Sein Max bedient exakt das Klischee
des Zürchers: Er ist laut, Dauerredner, weiß alles besser und
ist nie um eine Antwort verlegen.
Besser haben es da die Berner Kollegen (Kolleginnen sind mir keine bekannt). Die berndeutsche Mundart ist in ihrer Syntax dem Englischen näher verwandt als etwa Zürichdeutsch, die Ostschweizer Dialekte oder auch Hochdeutsch. Ein Beispiel: Schweizerinnen und Schweizer sind in der Liebe vorsichtig. Wenn es im Bauch zu kribbeln beginnt, säuseln wir höchstens: "ich hab dich gern" oder "ich mag dich". Auf Berndeutsch heißt das dann "i ha di gärn" (das "ä" wird etwa so ausgesprochen wie das "a" beim englischen "Jack"). Auf Zürichdeutsch heißt es "ich ha dich gärn" (das "ä" tönt hier wie bei "Diane" in breitem Südstaaten-Amerikanisch. Wo Zürcher das "ch" von "ich" kratzig kehlig aussprechen, lassen Berner diesen Reibelaut einfach weg.
Wie aber konnte in Bern eine breite Mundart-Szene entstehen, wo gleichzeitig
junge Musiker in der übrigen Schweiz mehrheitlich mit einem Auge ins
Ausland schielten? Martin Hauzenberger,
 Berner Liedermacher mit aktuellem Zürcher Wohnsitz,
verweist auf eine lange Tradition Berner Mundartschaffens: "Schon Jeremias
Gotthelf (19. Jh.) dichtete Berndeutsch und schrieb Dialekttheater." Wegbereiter
und Übervater des Berndeutschen Chansons ist jedoch Mani Matter, dessen
dreißigster Todestag Anlass zu einem Dokumentarfilm und einer
Würdigung im Herbst 2002 gab. Matter war für die
Berner Liedermacher mit aktuellem Zürcher Wohnsitz,
verweist auf eine lange Tradition Berner Mundartschaffens: "Schon Jeremias
Gotthelf (19. Jh.) dichtete Berndeutsch und schrieb Dialekttheater." Wegbereiter
und Übervater des Berndeutschen Chansons ist jedoch Mani Matter, dessen
dreißigster Todestag Anlass zu einem Dokumentarfilm und einer
Würdigung im Herbst 2002 gab. Matter war für die
 Berner-Szene
vielleicht das, was ein Dylan für die englischsprachigen Songwriter
war. Musikalisch von Brassens beeinflusst, waren seine Lieder, die er mit
einfachstem Folk-Picking begleitete, etwas gänzlich Neues für die
Schweiz und von kaum zu übertreffender textlicher Qualität. Als
Hugo Ramseyer, der spätere Gründer des Zytglogge-Verlags, mit den
ersten Aufnahmen bei den Zürcher Niederlassungen der großen
Plattenfirmen vorsprach, hatte man für ihn und seinen Schützling
allerdings nur ein Lächeln übrig. Darauf beschloss Ramseyer, Matters
Lieder selbst zu verlegen. Der Erfolg der versponnenen, mit einem feinen,
hintergründigen Humor unterlegten Chansons ließ nicht lange auf
sich warten. Schon bald kannte jedes Schulkind das Lied vom "Zundhölzli",
vom Streichholz, das fast einen dritten Weltkrieg verursachte oder dasjenige
vom Cembalo spielenden Eskimo, der von einem Eisbär aufgefressen wurde.
Mit Mani Matter als Zugpferd war beim Zytglogge-Verlag der Grundstein für
den weitaus wichtigsten Verlag Schweizer Liedschaffens mit Schwerpunkt Bern
gelegt. Der Musikwissenschaftler und Musiker Urs Frauchiger bescheinigt dem
Chansonnier im Dokumentarfilm "Warum syt dir so truurig", dass dieser mit
seinen Liedern die Berner Mundart als Ausdrucksform in der Kunst und im
intellektuellen
Berner-Szene
vielleicht das, was ein Dylan für die englischsprachigen Songwriter
war. Musikalisch von Brassens beeinflusst, waren seine Lieder, die er mit
einfachstem Folk-Picking begleitete, etwas gänzlich Neues für die
Schweiz und von kaum zu übertreffender textlicher Qualität. Als
Hugo Ramseyer, der spätere Gründer des Zytglogge-Verlags, mit den
ersten Aufnahmen bei den Zürcher Niederlassungen der großen
Plattenfirmen vorsprach, hatte man für ihn und seinen Schützling
allerdings nur ein Lächeln übrig. Darauf beschloss Ramseyer, Matters
Lieder selbst zu verlegen. Der Erfolg der versponnenen, mit einem feinen,
hintergründigen Humor unterlegten Chansons ließ nicht lange auf
sich warten. Schon bald kannte jedes Schulkind das Lied vom "Zundhölzli",
vom Streichholz, das fast einen dritten Weltkrieg verursachte oder dasjenige
vom Cembalo spielenden Eskimo, der von einem Eisbär aufgefressen wurde.
Mit Mani Matter als Zugpferd war beim Zytglogge-Verlag der Grundstein für
den weitaus wichtigsten Verlag Schweizer Liedschaffens mit Schwerpunkt Bern
gelegt. Der Musikwissenschaftler und Musiker Urs Frauchiger bescheinigt dem
Chansonnier im Dokumentarfilm "Warum syt dir so truurig", dass dieser mit
seinen Liedern die Berner Mundart als Ausdrucksform in der Kunst und im
intellektuellen
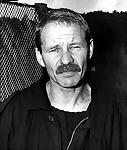 Diskurs
salonfähig gemacht habe. In der Folge traten unzählige Liedermacher
in Matters Fussstapfen. Mani Matter und seine Musikerfreunde, die " Berner
Troubadours", Ruedi Krebs, Bernhard Stirnemann, Jacob Stickelberger, Markus
Traber und Fritz Widmer, fanden in Bern
Diskurs
salonfähig gemacht habe. In der Folge traten unzählige Liedermacher
in Matters Fussstapfen. Mani Matter und seine Musikerfreunde, die " Berner
Troubadours", Ruedi Krebs, Bernhard Stirnemann, Jacob Stickelberger, Markus
Traber und Fritz Widmer, fanden in Bern
 gute Auftrittsbedingungen vor. In den sechziger
Jahren entstanden dort viele Kleintheater, so genannte Théâtres
de Poche.
gute Auftrittsbedingungen vor. In den sechziger
Jahren entstanden dort viele Kleintheater, so genannte Théâtres
de Poche.
Mani Matter verunglückte am 24. November 1972 tödlich auf der Fahrt zu einem Konzert. Hätte er den Zug genommen, wäre er vielleicht noch am Leben. Womöglich zog er die Fahrt im eigenen Wagen vor, um der Tristesse zu entfliehen, die er in seinem "Lied vo dä Bahnhöf" beschreibt. Der 36-jährige Liedermacher, hauptberuflich Rechtskonsulent der Stadt Bern, befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Neben den Troubadours, die Matters Erbe aufrechterhielten, entdeckten junge Liedermacher neue Ausdrucksformen. Die Berner Tinu Heiniger und Martin Hauzenberger, der Bündner Walter Lietha, der Basler Ernschd Born oder der Zürcher Toni Vescoli orientierten sich weniger an der französischen Chansonkultur als an Bob Dylan und amerikanischen Protestsongs.
|
|
|
|
|
|
!!! |
Folker!
- ...und immer noch: über 40% sparen beim
Folker!-Schnupperabo! |
Mehr über Berner Lieder |