AVISHAI COHEN
Continuo
(Razdaz Nocturno NTCD 393, www.avishaimusic.com)
10 Tracks, 50:35
Hört man „Israel“ in Verbindung mit Musik, blitzen verschiedene
Klischees durch das Rezensentenhirn: Klassik (Philharmonie wie
Dirigenten), Folkloremusik oder auch Ethnisches. Nichts dergleichen
liegt jedoch hier vor: Dieses Album muss ohne Zweifel in die Sparte
„Jazz“ eingereiht werden, und sollte der Platz ein Gradmesser von
Qualität sein, müsste es irgendwie in einer der vordersten Reihen
liegen. Avishai Cohen (Jahrgang 1970) gilt als einer der
profiliertesten Bassisten unserer Zeit weltweit, sein jüngstes Album
von insgesamt sieben erschien kürzlich auf dem künstlereigenen Label
Razdaz. Im Laufe seiner Karriere spielte Cohen in Formationen wie der
von Herbie Hancock oder der von Chick Corea u. a. Geprägt von den
vielfältigen ethnischen und musikalischen Einflüssen seines
Heimatlandes bewegt er sich frei-jazzig, wenn dieser Ausdruck erlaubt
sein sollte, in Bereichen von Jazz, Blues, Latino und nahöstlichem
Orient. Begleitet wird er von Mark Guiliana (Percussion, u. a. mit
Bobby McFerrin) und dem überraschend jungen Israeli Shai Maestro am
Piano (Jahrgang 1987). Als Gast auf diesem Album konnte man den
fantastischen Autodidakten Amos Hoffman mit seiner Oud für immerhin
fünf der insgesamt zehn Stücke gewinnen. Alles in allem: Nahostjazz in
spielerischer Perfektion.
Matt Goldschmidt
| 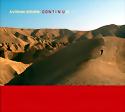
|
CHAVA ALBERSTEIN
Lemele
(Rounder RRECD 17/inakustik)
13 Tracks, 50:34, mit Texten (engl./franz./hebr./jidd.)
Albersteins erstes Album erschien vor ziemlich genau 40 Jahren: 1967
unter dem Titel Hineh Lanu Nigun (= „hier haben wir eine
Weise“). Wortwörtlich Dutzende von Alben später präsentiert die in
Stettin gebürtige israelische Sängerin ein weiteres Album auf
Jiddisch, ihrer Muttersprache. Erschienen bereits im letzten Jahr,
entpuppt sich „Lämmchen“ (jidd.: Lemele) mehr als ein würdiger
Nachfolger von The Well (1998; gemeinsam mit den Klezmatics)
und einer Sammlung „jiddischer Lieder“ (1999). Dafür sorgen vor allem
die ausgezeichneten musikalischen Arrangements tschechischer Musiker
unter der musikalischen Leitung von Aleš Brezina, etwa in „Ein Tag
vergeht“ mit Michal Pavlkik (Dudelsack). Außer einer Reihe von
Gastmusikern wurde nämlich ein aus zwölf Kammermusikern bestehendes
Studioorchester beschäftigt.
Wie seit Beginn ihrer künstlerischen Karriere komponiert Alberstein
fast alle ihre Lieder und Weisen selbst. Die Texte stammen u. a. von
Yehoash alias Solomon Bloomgarden (1870-1927), Abraham Avrum Reisen
(1876-1953, im CD-Beiheft fälschlicherweise Reisin buchstabiert) oder
Arn Glants-Leyeles (1889-1966) - notabene alles längst im Exil, d. h.
den USA oder Israel verstorbene Größen jiddischer Literatur, sollten
sie nicht von den Nazis ermordet worden sein.
Matti Goldschmidt
| 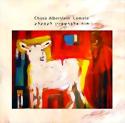
|
MUSTAFA KANDIRALI
dto.
(Traditional crossroads, TRAD 6004/SunnyMoon)
15 Tracks, 66:32, mit türk./engl. Textbeilage im Hardcover
Was in manchen Ohren wie erfrischend moderner „Orient-Ethno-Jazz“
anmutet, erweist sich als eine orientalische Spezialität: die
individuelle Ausgestaltung von Musik mit reichlich Freiraum für
Variationen. Auf diesem Humus gedieh eine Lichtgestalt wie Mustafa
Kandirali, der schon frühzeitig die Schule verließ, um sich ganz
seiner Klarinette zu widmen. Seine Größe steckt in seinem
unverwechselbaren Stil, mit der er vor allem die türkischen
Tanzmelodien (oyun havasi) prägte. Wie dieser
Gänsehautklarinettist die Töne mit feinen rhythmischen Akzenten
verschleppt, wie er trillert, phrasiert, und dies alles mit einer
Federleichtigkeit, die gerade in äußerst dynamischen Passagen den
wahren Meister zeigt. Einige dieser schon historischen, aber gut
klingenden Aufnahmen bewegen sich in der Popästhetik der 60er und 70er
Jahre, mit E-Bass (anstelle der Oud) und E-Gitarre. Von Mitte der 50er
Jahre bis zum Tode seiner Frau im Jahre 1985 absolvierte er etwa 150
Studioproduktionen. In der Blütezeit der Beiruter Nachtclubs war
Mustafa Kandirali ein Stargast, in Istanbul jammte er mit Louis
Armstrong. In seinem Ensemble sammelte er großartige Solisten etwa an
der Trapezzither Kanun oder der Geige. Diese 100-seitige und mehr als
einstündige Hommage an die 78-jährige Musiklegende zeigt eine
erhebliche stilistische Bandbreite, wobei das vorbildliche Textbuch
Hintergrundinformationen zu jedem Stück liefert.
Birger Gesthuisen
| 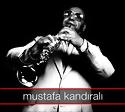
|