|
THE HANDSOME FAMILY
Last Days Of Wonder
(Loose Records VJCD166 / Rough Trade)
Promo-CD 12 Tracks, 43:31
„Brett and Rennie Sparks sind die beiden Hälften eines ebenso kranken wie
schönen Gehirns“, sagt Wilco-Mastermind Jeff Tweedy, der sich auskennt mit
dem Kranken im Schönen und dem Schönen im Kranken, über das Ehepaar aus
Albuquerque/New Mexico. Und Jeff White, der im preisgekrönten Film
Searching for the Wrong-Eyed Jesus kürzlich mit den beiden gemeinsam
einen reichlich ungeschminkten Blick auf die haarsträubenden Ränder der
Gesellschaft im amerikanischen Süden warf (siehe Folker! 04/2006),
präzisiert: „Obwohl ihre Songs von Verzweiflung, Sorge und Verderbtheit
beherrscht scheinen, liegt unter diesem grausigen Furnier eine überraschende
Zärtlichkeit. Es ist das Vermögen der Handsomes, diese beiden
gegensätzlichen Qualitäten zu verbinden, die das was sie tun so
unwiderstehlich macht.“ Ein stetes Americana-Schweben zwischen den
Schmeicheleien der lieblichsten Melodien, Harmonien und
Country-/Folkinstrumentierungen seit Pop in Altamont seine
Woodstock-Unschuld verlor, und dem sublimen Unheil, mit dem im hysterischen
Gute-Laune-Diktat der westlichen Welt letztlich noch jegliche
Oberflächenharmonie bedrohlich schwanger geht. Nicht umsonst erinnern Brett
und Rennie so viele an das berühmte Paar aus Grant Woods American
Gothic: Wer könnte der Idylle widerstehen, die sie repräsentieren? Wen
würde nicht schaudern beim Gedanken daran, wie der versierte „American
Psycho“ ihren Dreizack missbrauchen kann?
Christian Beck
| 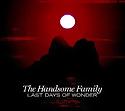
|
|
R. J. MISCHO
He Came To Play
(Crosscut Records CCD11087, www.crosscut.de)
14 Tracks; 49:14; zum Teil mit Texten
Als Außerirdischer zeigt sich R. J. Mischo auf dem spacig gestalteten
Cover seiner CD, und überirdische Momente gibt es so einige auf diesem
feinen Stück Harmonica-Blues. Einen eigenen Sound hat er in den letzten
Jahren geprägt, der in einem Gemisch aus 50er Jahre Chicago-Harp und dem
Jump-Blues der US-Westküste besteht. Dazu passt ganz hervorragend die
Vintage-Aufnahmetechnik des Albums. Die Musiker wurden nicht auf
getrennten Spuren aufgenommen und später zusammengemischt, sondern spielten
live im Studio zusammen. Das Ergebnis klingt dann auch eher wie ein
Konzertmitschnitt, Spielfreude und spontane Interaktion sind garantiert. Der
geneigte Hörer dankt’s und wird mit „20 % Alcohol“ in einen der „Juke
Joints“ am Wochenende entführt. In der alkohol- und rauchgeschwängerten
Atmosphäre bringt dort der Jump-Blues „Please Help“ den Saal zum kochen und
schleppt sich mit dem „Bluebird Blues“ durch die vorgerückte Stunde.
Tradition ist also der eine prägende Teil in R. J. Mischos Musik. Der andere
ist ein ungeheurer Spielwitz und ein Gespür für „passende Stilbrüche“.
Daraus entstehen dann so abgedrehte Stücke wie „Jokerhead“ oder das nur
zweiminütige „R. J. Come And Get It“, in dem R. J. Mischo die (eigene?)
häusliche Arbeitsteilung mit der einen Textzeile „You do the cookin’ and
I’ll do the eatin’, baby ...“ beschreibt.
Achim Hennes
| 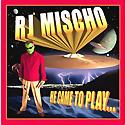
|
|
ANI DiFRANCO
Reprieve
(Righteous Babe RBR052-DE, www.righteousbabe.co.uk)
13 Tracks, 46:43, mit engl. Texten
Obwohl Reprieve bereits mindestens ihr 20. Album ist, klingt Ani
DiFranco erneut so als ob sie sich neu erfunden hätte. Dieses Mal hat sie
ihre fein gesponnene Lyrik in ein geradezu kammermusikalisches Gewand
gepackt. Wieder begleitet sich die Sängerin und Songschreiberin selber an
der Gitarre. Mit dem Kontrabassisten Todd Sickafoose gibt es jedoch nur
einen weiteren Mitwirkenden, der hier und da u. a. auch Piano und Harmonium
spielt. Alle 13 Titel hat Ani Difranco komponiert und arrangiert. Dabei hat
sie in ihre ruhigen, zugleich aber impressionistisch wirkenden Saitenklänge
überraschende Soundspielereien eingebaut wie Verkehrslärm, Vögel, Frösche,
Regen und Donner. Ihrer Stimme verleiht sie hier und da einen leicht
verzerrten Klang. Wie bei „Millenium Theater“ - einer Abrechnung mit der
republikanischen Regierung. Statt platter Reime wie ihn so vielen
Anti-Bush-Songs setzt Ani DiFranco geschliffenen Textzeilen ein, mit denen
sie die Missstände aufdeckt. Ähnlich politisch gibt sie sich beim Titelsong:
„Reprieve“ ist ein Spoken-Word-Stück über ein Thema, das sich wie ein roter
Faden durch das Werk der US-Amerikanerin zieht - die Auseinandersetzung mit
dem Patriarchat. Es ist neben ihren Liebesliedern ein beeindruckendes
Beispiel dafür, wie sie das Private und das Politische miteinander zu
verbinden versteht. Mit Reprieve hat Ani DiFranco ein weiteres
Meisterwerk vorgelegt!
Michael Kleff
| 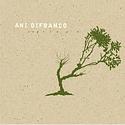
|
|
PINE LEAF BOYS
La Musique
(Arhoolie/FMS CD 520)
14 Tracks, 43:59
Die Pine Leaf Boys sind zwar eine neue Cajunband und die Musiker sind alle
erst Anfang 20, doch hört man sofort, dass hier richtig alte Hasen ihre
Instrumente bedienen. Akkordeonist Wilson Savoy ist der jüngste Sohn von
Anne und Marc Savoy, die schon seit mehreren Dekaden zu den Fixsternen des
Cajun-Universums gehören. An der Geige ist Fiddle-Wunderkind Cedric Watson
aus Houston/Texas mit von der Partie, dessen kreolische Interpretation des
Klassikers „Les Barres De La Prison“ einen imponierenden Höhepunkt dieser CD
markiert. Den Youngsters ist mit vorwiegend traditionellem Material ein
ebenso leichtfüßiges wie profundes Werk gelungen, das sie abgeklärt,
stilsicher und doch voller Leidenschaft vortragen. Technisch ist jeder der
fünf Musiker eine Klasse für sich, aber keiner lässt sich auf vordergründige
Gimmicks ein. Das Repertoire klingt und groovt äußerst homogen und der
Respekt vor dem musikalischen Erbe der Cajuns steht deutlich im Vordergrund,
was der Produktion angesichts der Jugend der Musiker eine bewundernswerte
Reife vermittelt.
Johannes Epremian
| 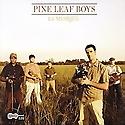
|
|
DIVERSE
Gospel Music
(Hyena Records HYN 9346/Rough Trade)
18 Tracks, 50:08, mit ganz knappen engl. Infos
Diesseitige Lust und jenseitige Entrücktheit - kein Wunder, dass der
weltweite Siegeszug der Black American Music gerade in dem Moment begann, in
dem eine Generation selten kraftstrotzender und hingebungsvoller Künstler
Feuer an die Lunten an beiden entgegengesetzten Enden des menschlichen
Jammertals gleichzeitig legten. Und es war beileibe nicht Brother Ray
Charles, der da zündelte wie ein Wilder, wie Generationen
hollywoodinfiltrierter Nachgeborener heute glauben könnten - man leihe nur
der vorliegenden, selten homogenen Zusammenstellung von Produzent Joel Dorn
und Photograph Lee Friedlander ein Ohr. Zu Recht in die Ruhmeshallen
eingezogene Ewige der schwarzen Musik sind ebenso vertreten wie zu Unrecht
in der Versenkung verschwundene Eintagsfliegen: Mahalia Jackson wie The
Violinaires, Sam Cooke wie The Swan Silvertones, The Staple Singers wie The
Angelic Gospel Singers, die Original Five Blind Boys of Alabama wie the
Trumpeteers. Gemeinsam ist ihnen allen nicht nur die Inbrunst, mit der sie
zur Sache gehen, sondern auch eine erstaunliche Zeitgemäßheit in Sound und
Produktion. Knackig, energisch, mitreißend - und ebenso breitbeinig im Hier
und Jetzt wie abgehoben in deutlich anderen Sphären. Die beiden
„This-May-Be-The-Last-Time“-Versionen der Original Five Blind Boys und der
Staple Singers Rücken an Rücken in der Mitte des Albums brauchen kein fünf
Minuten, um das ganze Spektrum zu entfalten.
Christian Beck
| 
|
|
JOE BONAMASSA
You & Me
(Provogue Records PRD71852 www.mascot-provogue.de)
Promo-CD; 11 Tracks; 50:17
Im Alter von vier Jahren begann er Gitarre zu spielen, mit elf trat er
bereits im Vorprogramm einer B.-B.-King-Tournee auf, und mittlerweile ist
der 29-Jährige dem Status des Geheimtipps längst entwachsen. Joe Bonamassa
singt und spielt auf der energischen und rockigen Seite des Blues, und mit
diesem Album wollte er sich stärker auf seine Wurzeln besinnen. Den Anfang
macht dabei das ehrwürdige „High Water Everywhere“ von Charlie Patton. Das
Original mit seinem stampfenden, schleppenden Rhythmus bleibt unverkennbar,
erhält durch die spärlichen, schneidenden Gitarrenlicks Bonamassas aber doch
einen eigenen Charakter. Im eher verhaltenen Midtempo geht es mit „Bridge To
Better Days“, einer Eigenkomposition, weiter, dessen treibendes Riff sich im
Mittelteil in einer heftigen Gitarreneruption entlädt - laut, schnell und
äußerst geschmackvoll gespielt. Versöhnlich folgt das orchestrale „Asking
Around For You“ in bester B.-B.-King-Manier, und auch zwei auf der
akustischen Gitarre gespielten Stücke sind dabei: Ry Cooders „Tamp Em Up
Solid“ in einer Fingerpickingversion und das rasante, rein instrumentale
„Palm Trees Helicopters And Gasoline“. Und dann „Tea For One“, ein Song
meiner Helden der 1970er, bei dem es Joe Bonamassa gelingt, die Stimmung zu
malen, die im Kopf nach einem durchfeierten Wochenende mit der Musik von Led
Zeppelin nachhallte. Zusätzliche Magie entsteht dadurch, dass Jason Bonham,
Sohn des legendären Led-Zeppelin-Drummers John Bonham, hier am Schlagzeug
sitzt.
Achim Hennes
| 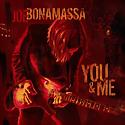
|
|
ILENE BARNES
Yesterday Comes
(Nektar/Tropical Music 68.855/Sony BMG, www.tropical-music.com, www.ilenebarnes.com)
12 Tracks, 50:32, mit engl. Songtexten und dt. Infotext
Als die Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Ilene Barnes 2004 als
Opener von Eric Burdon ihr Album Time im Gepäck hatte, kannte sie
hierzulande kaum jemand. Wider Erwarten gelang es ihr, allein mit Gitarre
und Stimme bewaffnet, dem Publikum aus Altrockern und Burdon-Fans
tatsächlich ein wenig Aufmerksamkeit abzuringen. Schon Time stellte,
als ihr zweites Album, einen Neuanfang dar - nach dem vorangegangenen
Versuch eines Majorlabels, sie als unfreiwillige „zweite Grace Jones“ zu
vermarkten. Nun konsolidiert Ilene Barnes mit Yesterday Comes ihre
zweite Karriere: Die in Detroit geborene, in Surinam, Barbados und Jamaika
aufgewachsene Sängerin mit indianisch-afroamerikanischen Wurzeln legt
ordentlich nach. Ihre ausdrucksstarken Lieder changieren zwischen Blues,
Rock und klassischem Songwritertum, aus ihren Texten sprechen Erfahrung und
Nachdenklichkeit. Ilene Barnes ist eine faszinierende Frau, eine Künstlerin,
die mit tiefer, wandlungsfähiger Stimme den Hörer in einen Sog aus
Leidenschaft, Energie und Überzeugungskraft zieht. Sie hat eine Botschaft
und weiß es, Geschichten zu erzählen. Wer wollte ihr nicht zuhören, wer
könnte sich dieser charismatischen Stimme entziehen?
Carina Prange
| 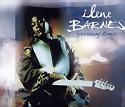
|
|
DIVERSE
In Prison - Afroamerican Prison Music From Blues To HipHop
(Trikont US-0356, www.trikont.de)
19 Tracks, 73:49, mit engl. und dt. Infos
Nach den beiden CDs Black & Proud über die Musik in der Ära der
Black-Panther-Bewegung haben die Trikont-Macher jetzt wieder eine Produktion
vorgelegt, die sich als ein klingendes Geschichtsbuch erweist - und daher in
jeden Musikunterricht gehören sollte. „Wenn eine Nation darüber definiert
wird, was sie produziert, dann sind die Vereinigten Staaten eine
Gefängnisnation geworden.“ Dieses Zitat von Alan Elsner steht am Anfang des
Booklettextes von In Prison. Was Jonathan Fischer und Ian Ensslen
dann auf acht Seiten an Fakten über die Geschichte von schwarzen Häftlingen
in den USA zusammentragen, findet sein klingendes Spiegelbild in den 19 von
beiden Autoren als Hörbeispiele auf der CD zusammengestellten Songs. Sie
reichen von „klassischen“ Aufnahmen wie dem 1959 in der ehemaligen Plantage
Angola, Louisiana, - einst eines der blutrünstigsten Gefängnisse Amerikas -
entstandenen Worksong „Berta“ mit Big Louisiana, Rev. Rogers und Roosevelt
Charles über „Short Eyes“, der 1977 von Curtis Mayfied zu seinem
gleichnamigen Gefängnisfilm geschriebenen Musik bis zu „16 On Death Row“ vom
1996 ermordeten Rapper Tupac. Diese Songs erzählen ebenso wie alle übrigen
Titel u. a. von den Escorts, Robert Pete Williams, Nina Simone und den Last
Poets Geschichten sowohl über die Unterdrückung der Afroamerikaner im US-
Justiz- und Gefängnissystem als auch von ihrem Widerstand dagegen.
Michael Kleff
| 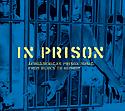
|
|
BIG YELLOW TAXI
Unknown And Famous Songs Of Joni Mitchell
(HOMusik HOCD8/www.bigyellowtaxi.dk)
13 Tracks, 45:40, mit engl. Infos
DAVID ROTH
More Pearls
(Stockfisch Records SFR 357.6041.2/in-akustik)
14 Tracks, 65:53, mit ausführlichen engl. Infos
GRANT-LEE PHILLIPS
Nineteeneighties
(Cooking Vinyl COOKCD380/Indigo)
Promo-CD 11 Tracks, 44:00
Lieber die großen Meisterwerke der Popgeschichte zu covern, als ihnen
Epigonen hinzuzugesellen, die es ohnehin nie auf Augenhöhe mit den
Vorbildern schaffen können, ist grundsätzlich ein vernünftiger Gedanke. Wenn
dabei wie im Falle von Big Yellow Taxi aus Dänemark auch noch gänzlich
unveröffentlichte Tunes einer veritablen Legende präsentiert werden,
sowieso. Gleich drei von der Autorin autorisierte Erstveröffentlichungen
kann BYT-Mastermind Henning Olson mit „Come To The Sunshine“, „The Way It
Is“ und „Carnival In Kenora“ auf seinem zweiten Joni-Mitchell-Album
präsentieren: Dem Vorbild auch im Gesang Christina Friis’ etwas sehr
anverwandt, wenn auch nicht von der Rätselhaftigkeit des Originals, so dafür
zugänglicher.
Deutlich weniger Mimikry legt David Roth in seinem zweiten Coveralbum an
den Tag, was schon aufgrund des breiteren Spektrums der Vorlagen logisch
ist: Von Pete Seeger über Bob Dylan, Peter, Paul & Mary, Gordon
Lightfoot, Ralph McTell und zahlreiche andere Unantastbare bis zu Carol King
haben es dem amerikanischen Gitarristen und Sänger vor allem die großen
Singer/Songwriter seiner Kindheit und Jugend angetan - mit einer Ausnahme:
den Beatles. Auch ihr „I Will“ verleibt er seiner ebenso makellos
musizierten wie gesungenen, opulent instrumentierten Folkvariante aber
reibungslos ein - bei der übermäßig respektvollen Ernsthaftigkeit, mit der
er zu Werke geht, auch kein wirkliches Wunder.
Grant-Lee Phillips geht da mit seinen Vorlagen von The Pixies, New Order,
Joy Division, Robyn Hitchcock, Echo and the Bunnymen, Psychedelic Fus, The
Church, Nick Cave, R.E.M. oder The Smiths als Kind der
90er-Indie-/Alternativ-Generation naturgemäß schon deutlich unbefangener um.
Wie er sie alle regelrecht einebnet in ein doch ziemlich stumpes
Americana-Gewand scheint zwar nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein,
„Boys Don’t Cry“ von The Cure aber kommt verglichen mit dem schwerblütigen
Original regelrecht federleicht daher, mit Banjo als Folktune, ein ganz
entzückender, regelrecht aufregender Verfremdungseffekt. Nicht die
schlechteste Qualität, über die eine Coverversion verfügen kann.
Christian Beck
| 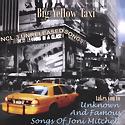
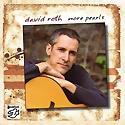
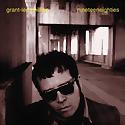
|