|
MARTIN BÜSSER
Antifolk: Von Beck bis Adam Green
Mainz: Ventil-Verlag, 2005, 150 S.
ISBN 3-931555-93-3
Vor wenigen Jahren widmete die Wochenzeitschrift Die Zeit dem
Phänomen „Antifolk“ eine halbe Seite im Feuilleton. Das ist schon etwas, da
sich das Hamburger Blatt ansonsten nur wenig um Themen rund um „Folk“
kümmert. Es sei denn, es geht um Bob Dylan. Doch das ist ein anderes Thema ...
Was verbirgt sich hinter dieser Musik, die zwar vorgeblich eine ganze Flut
von Begeisterung ausgelöst hat, deren Interpreten jedoch nur Eingeweihten
bekannt zu sein scheinen. Martin Büsser, Herausgeber der Jahreszeitschrift
testcard, versucht in seinem Buch eine Antwort und liefert das erste
Antifolk-Kompendium. Darin gibt der Autor einen Abriss über die Entwicklung
der Folkmusik von Woody Guthrie und Bob Dylan bis zum Antifolk heute. Er
beschäftigt sich mit der Einfachheit und dem Do-it-yourself-Gedanken des
Genres und legt zum besseren Verständnis auch gleich eine
Auswahldiscographie vor mit „Vorläufern und Artverwandten“, zu denen er u.
a. die Fugs, Godz, die Holy Modal Rounders, Daniel Johnston, Pearls Before
Swine und Tiny Tim zählt, sowie ein „Antifolk-ABC“ von American Anymen bis
Testosterone Kills. Besonders gewürdigt werden die jüngeren Protagonisten
des Antifolk, darunter Jeffrey Lewis, Herman Düne, Kimya Dawson, Dufus und
natürlich Adam Green, dessen CDs und vor allem dessen 2005 im Suhrkamp
Verlag veröffentlichtes Buch mit Gedichten und Prosa die Antifolkszene in
Deutschland bekannt machten. Definiert wird Antifolk als eine Richtung, die
für Folk das bedeutet, was Punk für Rock gewesen sei. Büsser zitiert den New
Yorker Songwriter Lach, der in den 80er Jahren gesagt haben soll: „Wenn das
Folk ist, dann bin ich Antifolk!“ Bleibt die Frage, was uns das sagen soll.
Und wo der politische Aspekt steckt, vor allem im Blick zurück, wo Gruppen
wie die Fugs sich in ihren Aussagen deutlich von Hippiefolkies wie Pearls
Before Swine unterschieden. Martin Büsser will im Dilettantismus der
aktuellen Antifolkszene ein „antikapitalistisches Gegenmodell zur
leistungsorientierten Erwachsenenwelt“ sehen. Den Erfolg beim Publikum
begründet er so: „Die musikalisch erzeugten Brüche lassen Minorität zu einer
solidarischen Kollektiverfahrung werden und zeigen, dass Mehrheit und
Normalität nichts weiter als Konstruktionen jener sind, die Interesse am
Erhalt der bestehenden Ordnung haben. Antifolk vermittelt das Gefühl, dass
es zwar kein Außerhalb der Gesellschaft gibt, vielleicht aber ein Außerhalb
der Macht.“
Michael Kleff
| 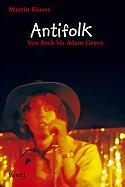
|
|
GERTRUD MEYER
Volkstanzsammlungen
Reprint der Tanzhefte Tanzspiele und Singtänze, Volkstänze (2. Aufl.), Volkstänze (8. Aufl.), Tanzspiele und Volkstänze - Neue Folge sowie Beitr. von Volker Klotzsche, Hannover. Hrsg. Landesarbeitsgemeinschaft Tanz
O. O.: Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Schleswig-Holstein, 2002
getr. Seitenzählung, mit zahlr. Noten u. Nachdr. d. alten Titelblätter
Ein zeitloses Buch, ein Buch ohne „Markt“, das vor allem aus
leidenschaftlichem Interesse hergestellt wurde, verdient einer, selbst
späten, Erwähnung. Gerade weil es einer kurzen Episode deutscher Traditionen
gewidmet ist: den Tänzen, Liedern und Singspielen aus der Zeit der
Jugendbewegung, die mit der Nazizeit recht zügig gleichgeschaltet, sprich
beendet wurde. Damals gab es eine kurze Blüte einer modernen Volkskultur,
die sich zwar an den Traditionen orientierte, diese aber recht unbekümmert
in den Zeitgeist des Industriezeitalters brachte. Körperlicher und
seelischer Ausgleich durch Tanz und Spiel in der Natur, Erhaltung von
menschlicher Ursprünglichkeit, Erleben von Gemeinschaft - viele Ideale
standen hinter der Jugendbewegung. Vielleicht die letzte Chance neuerer
deutscher Geschichte, sich mit der eigenen Tradition weiterzuentwickeln?
Diese Sammlung von mehreren hundert Tänzen, von denen uns heute verblüffend
viele noch immer bekannt sind, lässt uns ahnen, welche Dynamik der Volkstanz
damals noch einmal erreichte. Gertrud Meyers Tanzsammlungen stellen eine
frühe repräsentative Tanzsammlung dar, die die Treffen der Jugendbewegten
wesentlich prägten.
Die LAG hat einen Nachdruck des gesamten tänzerischen Werkes von Gertrud
Meyer (1877-1966) geschaffen, welches im Wesentlichen aus drei Tanzbüchern
aus der Zeit der Jugendbewegung besteht. Mit dem originalen Werbeteil des
Leipziger Verlages Teubner aus dieser Zeit, Photos und einem kurzen Beitrag
des Volkstanzforschers Volker Klotzsche. Eine Spezialität, für die man schon
spezielles Interesse aufbringen muss, die aber Begeisterung bei jedem
auslösen kann, der sich diesem Fundus einmal nähern und aus eigener
Tradition schöpfen will. Der Anteil nichtdeutscher Tänze, von Gertrud Meyer
teilweise mit deutschen Texten und Spielideen versehen, schafft eine ganz
andere Atmosphäre von Weltmusik als die, die wir heute kennen.
Jürgen Brehme
Bezug: LAG Tanz, Jürgen Fularzik, Ginsterbusch 6, 24146 Kiel
| 
|
|
OLEA CRØGER
Lilja bære blomster i enge:
Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra.
Hrsg. Brynjulf Alver
Oslo: Norsk folkeminnelag, 2004
(Norsk folkeminnelags skrifter; 112)
ISBN 82-03-19015-4
Später Ruhm! Olea Crøger (1801-1855) war Norwegens erste bedeutende
Volksliedsammlerin und offenbar eine unerschrockene Frau. Sie stellte die
überaus unpopuläre Behauptung auf, es gebe norwegische Volkslieder, die des
Sammelns absolut wert wären, und nicht alles im Lande seien zersungene, zur
Zeit der Dänenherrschaft eingeschleppte dänische Gassenhauer. Ihre Sammlung
bewies, dass sie recht hatte; die gleichzeitig sammelnden Herren ließen sich
von ihr beraten und inspirieren und nahmen dann auch gleich die von Frau
Crøger gesammelten Stücke in ihre eigenen Veröffentlichungen auf, ohne
Crøger als Quelle zu nennen. Wenn Olea ihr Material zurückforderte,
reagierten die Herren sauer, denn schließlich ziemte es sich nicht für ein
unverheiratetes Frauenzimmer, einfach so Bücher herauszugeben, schon gar
nicht für eins, das mit zwei weiteren unverheirateten Frauenzimmern einen
Hof betrieb, wo sie, weil sie kein Gesinde bezahlen konnten, „Knechtsarbeit“
verrichteten (wie einige der gelehrten Herrn in ihrer Korrespondenz
angeekelt mitteilten).
Nicht immer wurden Olea Crøgers Leistungen dermaßen unter den Teppich
gekehrt, weshalb wir sie in Büchern zum Thema erwähnt finden, eben als erste
norwegische Volksliedsammlerin, deren Vorgehensweise auch für die anderen
nordischen Länder Vorbild war. Ihr unkonventionelles Leben hat sie sogar zur
Heldin einer vierbändigen Romanserie werden lassen (leider nicht ins
Deutsche übersetzt), und nun endlich, zum 150. Todestag, ist ihre Sammlung
erstmals als Buch erschienen. Herausgegeben - natürlich - vom Norwegischen
Volkskundeverband, Norsk Folkeminnelag, der an dieser Stelle ja schon
häufiger gepriesen wurde. Zwei Bände mit insgesamt ca. 500 Seiten enthalten
ihren Lebenslauf, ihre gesammelten Lieder in allen Varianten, ihre
Notensammlungen und die Faksimiles der Notierungen, die ihre höchst eigene
Form von Ziffernnotierung für Melodieführung zeigen. Und Letzteres, Noten
und Faksimiles, machen das Werk auch hochinteressant für
Nicht-Norwegischkundige. Noch interessanter wird es durch die beiliegende
CD: Agnes Buen Garnås singt, begleitet von Gøril Ramo Håve (Langeleik) und
Jørun Bøgeberg 13 von Olea Crøger gesammelte Lieder, dazu gibt es ein von
ihr notiertes Instrumentalstück.
Gabriele Haefs
Bezug: Norsk Folkeminnelag, Postboks 2372 Solli, 0201
Oslo, Norwegen, eMail nfl@kulturvern.no
| 
|
|
DORLE FERBER, SUSANNE STEFFE
Alte Kinderlieder - neu entdeckt
Gemeinsam singen und spielen mit den schönsten traditionellen Liedern.
Ill. Mientje Meussen
Münster: Ökotopia-Verlag, 2006
125 S., mit zahlr. Noten u. Abb, plus CD (63:15)
ISBN 3-936286-84-1/3-936286-85-X
Als Lieder noch nicht auf CD gepresst und überall angeboten wurden,
mussten sie sich noch durch steten Gebrauch erhalten. Was eingängig und
passend war, wurde immer wieder gesungen und getanzt und erhielt sich so im
Gedächtnis der Generationen. In diese Zeit gingen die Autorinnen
(Musikerinnen und Autorinnen, u. a. auch Geschichten und Lieder mit der
Maus) zurück, um authentisches Liedgut wieder lebendig zu machen. Und
siehe da - trotz Medienzeitalter habe ich fast alle Lieder noch gekannt, die
im Buch entweder recht originalgetreu benutzt oder als Grundlage für Spiele
und Bewegungsgeschichten bearbeitet wurden. Zu den Themenbereichen gibt es
erläuternde Texte und neue Ideen, Zählreime, Zungenbrecher,
Bastelanleitungen. Eine umfassende Bearbeitung also, mit Blick auf
Praktikabilität für die heutige Zeit. Dafür ist zum Beispiel auf die
ursprünglichen Dialekte einiger Überlieferungen verzichtet worden. Obwohl
nur im Paperback, entspricht auch dieses Buch in Sachen inhaltliche Qualität
und Gestaltung den gewohnt hohen Ansprüchen des Ökotopia-Verlages, der
inzwischen auf über zwei Dutzend solcher Bücher, zumeist mit CD, verweisen
kann.
Die CD dazu, eingespielt unter Leitung von Dorle Ferber und Hartmut
Höfele, enthält wieder alle verwendeten Stücke, dazu ein paar Zwischentexte
- schon als klingende Liedersammlung ein Kinderzeit-Erinnungsvergnügen.
Jürgen Brehme
| 
|
|
JOHNNY LAMPRECHT
Trommelzauber
Kinder lernen trommeln und erleben Afrika mit Liedern, Rhythmen, Tänzen, Geschichten und Spielen
Ill. Kerstin Heinlein
Münster: Ökotopia-Verlag, 2006
122 S., mit Noten u. zahlr. Abb., plus Do-CD (54:50/79:27)
ISBN 3-936286-86-8/3-936286-87-6
Dieses Buch hebt sich etwas ab von dem Ökotopia-Programm, das ich hier
sonst vorstelle. Denn es ist ein „Solo“, ein spezielles Werk von einem Mann,
der mal Theologie studierte, doch danach nur noch trommelte und trommeln
ließ. Magische Trommelerlebnisse, Begegnungen mit Trommlern und Trommeln
inspirierten ihn zu einem lebendigen Konzept. Johnny Lamprecht trommelt seit
ca. zehn Jahren mit Kindern im Schul- und Vorschulalter - Mitmachkonzerte in
der „afrikanischen Dreieinigkeit“ von Trommeln, Singen, Tanzen. Durchaus in
großen Gruppen (zum Beispiel mit bis zu 400 Kindern einer Grundschule), aber
auch als Fortbildungen für Fachleute. Mit diesem Buch gibt er den
Trommelzauber weiter an alle Interessierte, die das in jeder Art von Gruppe
umsetzen wollen. Dabei ist durchaus auch an Leute ohne große musikalische
Vorkenntnisse gedacht, denn die Trommel erfordert nicht unbedingt
Notenkenntnisse. Das ist kein reines Lehrbuch, obwohl es natürlich
Beschreibungen von Schlagtechniken, Trommelbauanleitungen, Lieder und
Trommelspiele und Einiges andere enthält. Die Doppel-CD liefert alle Lieder
des Buches, Playbackversionen und Instrumentalstücke. Doch der Zauber zum
Lehrbuch kommt aus seinen afrikanischen Geschichten, aus den Erlebnisseen
mit Menschen, die er in Text und Bild dazu liefert, aus den
begeistert-sachlichen Erzählungen über das Leben von Afrikanern und der
Rolle der Trommel darin. Ganz ohne berührt zu sein, kann man dieses Buch
nicht weglegen, diese Musik nicht ausschalten.
Jürgen Brehme
| 
|
|
FRITZ RAU
50 Jahre Backstage
Erinnerungen eines Konzertveranstalters
Vorw. v. Udo Lindenberg. Originalausg.
Heidelberg: Palmyra Verlag, 2005
303 S., mit s/w-Photos
ISBN 3-930378-65-5
Die Lektüre dieses Buches lässt einen mit einem zwiespältigen Gefühl
zurück. Unbestritten hat Fritz Rau, der in diesem Jahr 76 geworden ist,
gemeinsam mit seinem verstorbenen Partner Horst Lippmann der Kultur in
Deutschland seinen Stempel aufgedrückt. Als Konzertveranstalter öffneten sie
das Land für Jazz und Blues, brachten junge Bands wie die Rolling Stones und
die Animals auf die Bühne, schickten so unterschiedliche Interpreten wie
Peter Maffay und Udo Lindenberg auf Tour; ganz zu schweigen von der Liste
der übrigen Stars die durch Lippmann+Rau nach Deutschland geholt wurden.
Raus Buch ist ein Zeitdokument in Anekdotenform - „Vom Kofferträger zum
Tourneeleiter“, „Woodstock und die Folgen: Open-Air-Konzerte in
Deutschland“, „Demokratische Mosaikkultur: Die Grüne Raupe und andere
politische Veranstaltungen“, „Wer sich weiterentwickelt, ist kein Oldie“
usw. Durch die direkte Art von Raus Erzählstil erfährt man viel nicht nur
über das Musikgeschäft und seine Veränderungen im Laufe von 50 Jahren,
sondern auch über Künstler und ihre Macken. Die Fülle an interessanten
Informationen lässt darüber hinwegsehen, dass Raus Autobiographie sehr
ichbezogen wirkt. Ein Lektor wäre hier hilfreich gewesen, auch um so manchen
Fehler, Wiederholungen und die eine oder andere Banalität zu streichen. Die
für mich interessantesten Passagen finden sich in den letzten Kapiteln, in
denen sich Fritz Rau mit der Entwicklung eines Konzerthandwerks vor
50 Jahren zur Konzertindustrie heute beschäftigt, wobei er es hier
leider bei der Beschreibung der Veränderungen belässt und die negativen
Auswirkungen der zunehmenden Monopolisierung auf dem Markt nicht
thematisiert. Das steht im Widerspruch zu Raus nur wenige Seiten später
postuliertem Lebensmotto, wonach er sich „eine Demokratisierung der Kultur
zum Ziel gesetzt“ habe. Kritisch wird der legendäre Konzertveranstalter in
seinen Memoiren jedoch, wenn es um die in Deutschland gepflegte fragwürdige
Trennung zwischen „ernster“ und „unterhaltender“ Musik geht. Da findet er
deutliche Worte und spricht von einem „arrogant-elitären
Betrachtungsschema“, das es zu überwinden gelte. Seine Musik der Zukunft
bezeichnet er als „EU-Musik“. Und damit ist nicht die Europäische Union
gemeint, sondern die gleichberechtigte Zusammenfassung von Künstlern der
E-Musik und der Unterhaltungskultur.
Michael Kleff
| 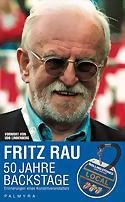
|
|
DER GITARREN SKALEN-FÄCHER
Berlin: Bosworth, 2006
ausschließl. Griffskalen mit Erl. in Form e. Gitarrenhalses. (Bosworth Edition; BOE7268)
ISBN 3-86543-129-1, ISMN M-2016-5166-8
DER ROCK-GITARREN SKALEN-FÄCHER
Berlin: Bosworth, 2006
ausschließl. Griffskalen mit Erl. in Form e. Gitarrenhalses. (Bosworth Edition; BOE7266)
ISBN 3-86543-127-5, ISMN M-2016-5164-4
Nicht direkt als Bücher kann man diese handlichen Fächer bezeichnen, die
der Bosworth-Verlag herausgegeben hat. Im Zeitalter elektronischer
Gitarrensatzprogramme und Akkordfinder im Internet sind die beiden Fächer
nur auf den ersten Blick anachronistisch. Der große Vorteil der
Skalenfinder, die sich in erster Linie als Übungsreferenz an den
Gitarrenanfänger richtet, ist: Sie passen im Gegensatz zu einem PC in jeden
Gitarrenkoffer. Wer schleppt schon jedes Mal einen Laptop mit zum
Gitarrenunterricht oder zur Probe.
Die jeweils auf dünnen Karton gedruckten, wie ein Gitarrenhals geformten
Fächer sind an einer Ecke mit einer Niete versehen, die man an diesem
Drehpunkt aufklappen kann. Auf den einzelnen Blättern findet man jeweils den
Fingersatz einer Skala abgebildet. Der Anfänger sieht exakt, wie eine Skale
liegt und wie sie gegriffen wird. Enthalten sind die am häufigsten benutzen
Tonarten C, G, D, A und E. Auf der Rückseite der Fächer finden sich die
Standardnotation und Tabulatur jeder Skala, Übungsmuster und Arpeggios. Ob
man sich für den Gitarren Skalen-Fächer oder den Rock-Gitarren
Skalen-Fächer entscheidet, ist einfach eine Frage der Optik, inhaltlich
sind beide absolut identisch. Nachteil der ansonsten handlichen Fächer ist,
dass die ausgeformten Seiten sich beim Zusammenschieben gern verhaken.
Ulrich Joosten
| 
|