|
DIVERSE
Stranded
(Trikont US-0326)
26 Tracks; 74:47; mit Infos
Auf der Suche nach Schellackplatten stieß Folker!-Autor Christoph Wagner im
Jahr 2002 in Illinois auf eine „Goldmine“ mit schätzungsweise 100.000 alten
Scheiben. Sie enthielten sizilianische Volksmusik mit Klarinette und
Mandoline, irische Jigs mit Banjo und Akkordeon, deutsche Weihnachtslieder und
böhmische Blasmusik, karibischen Calypso, jüdische Kantorgesänge sowie
skandinavische, chinesische, polnische, griechische sowie arabische Musik.
Gleich daneben stieß Wagner auf Kisten mit Platten früher Dancebands, Jazz,
Hillbilly, Bluegrass, Cajun, Gospel und Blues. Vor ihm eröffnete sich der
ganze „ethnische Untergrund der USA“. Beispielhaft sind auf „Stranded“ 26
Lieder von Auswanderern aus allen Ecken der Welt vertreten, die ihre Musik mit
über den großen Teich genommen haben. Und, so Wagners These, den Ausgangspunkt
für die US-Popmusik bildeten. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1922 bis
1959. Der Sampler ist gleich mit zwei Booklets versehen. In einem geht es ganz
allgemein um die Ein- bzw. Auswanderungsgeschichte sowie um die Entwicklung
der ethnischen Schallplattenindustrie in den USA. Im zweiten Beiheft werden
die Hintergründe der einzelnen Lieder und ihrer Interpreten erläutert. Wieder
einmal haben Christoph Wagner und Trikont ein Juwel vorgelegt.
Michael Kleff
| 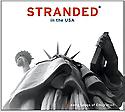
|
|
CARL WEATHERSBY
In The House
(CrossCutRecords ccd11081)
12 Tracks; 54:15; mit Infos
Vom „kleinen feinen“ zum „bedeutenden feinen“ Festival hat sich das jährlich
stattfindende „Lucerne Blues Festival“ in den letzten Jahren gemausert. Volume
5 der von „CrossCutRecords“ mitgeschnittenen Reihe zeigt Carl Weathersby,
einen Sänger und Gitarristen der „traditionellen Chicagoer Schule“, der
gemeinsam mit Paul Hendricks (Gitarre), Calvin „Skip“ Gaskin (Bass) und Leon
Smith (Drums) ein mitreißendes Konzert bietet. Neben Blues, Shuffles und
Stomps gibt es als Bonbon noch ein (..und leider nur ein...) Stück mit dem
Soulsänger Otis Clay und dem Harp-Spieler Billy Branch. Viele der Stücke haben
auch in der Länge „Live-Format“ und bieten mit über acht Minuten Spielzeit
genug Raum für Soli und immer wiederkehrende feurige „Duelle“ der beiden
Gitarristen. Etwas verhaltener und „näher an den Wurzeln“, aber mit mindestens
genauso viel Spielfreude geht das Down Home Super Trio in Volume 6 an den
Start. Der besondere Reiz geht hier von der Instrumentierung aus: R.J. Mischo
an der Harp, Frank Goldwasser spielt Gitarre und Richard Innes trommelt. Die
Gesangparts teilen sich R.J. Mischo und Frank Goldwasser. Bei zwei Stücken
werden sie von Alex Schulz und bei einem von Billy Flynn an der Gitarre
unterstützt. Besonders angetan haben es mir die Stücke „Grand Casino“, ohne
Gesang zwar, aber mit zwei fantastischen Gitarren und einer tollen Harp, und
„Homesick Blues“, nur mit Gitarre (Goldwasser) und Drums. Ohne Einschränkung
und wärmstens zu empfehlen.
Achim Hennes
| 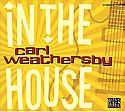
|
|
CHULRUA
Down the Back Lane
(Shanachie Records 22001/Just Records Babelsberg)
13 Tracks; 55:21, mit Infos
Chulrua, das sind Tim Britton - Uilleann Pipes, Paddy O'Brien - Button
Accordeon und Pat Egan - Guitar, Vocals. Nach einem mit dem Naturhall einer
Kirche aufgenommenen Erstling ist dies die zweite CD der in den USA ansässigen
Band. Auch wenn ich betonen muss, dass die beiden erstgenannten Musiker für
mich als Einzelpersönlichkeit künstlerisch eine Menge zu sagen haben,
hinterlässt die hier vorliegende Aufnahme sehr gemischte Gefühle. Tim Brittons
Uilleann Pipes Sound ist sehr nasal und durchaus gewöhungsbedürftig. Die
Kombination Uilleann Pipes/Accordeon ist ohnehin für mich mit das kritischste,
was im Bereich der traditionellen irischen Musik möglich ist. Leider schaffen
es auch Tim und Paddy nicht, einen wirklich homogenen Klangfluss und Groove zu
erzeugen, im Gegenteil, Tim Britton frönt ohnehin einer stark stakkatierten
Spieltechnik und wird hierin von Paddy O'Brien fast noch überboten. So
resultiert für den Hörer ein sprödes, nur wenig mitreißendes Klangbild. Neben
den dominierenden Instrumentals wirken die wenigen Lieder recht hausbacken und
treffen stimmlich/interpretatorisch meinen Geschmack zumindest überhaupt
nicht. Vom Repertoire her betrachtet bietet die Aufnahme dem Kenner und
Sammler trotzdem einige interessante Raritäten und ist für diese Zielgruppe
sicher wertvoll. Für Irish Folk Freunde ohne tiefergehende Fachkenntnisse
empfehle ich eine Hörprobe vor dem Kauf!
Johannes Schiefner
| 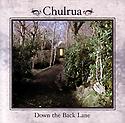
|
|
DIVERSE
Dirty Laundry
(Trikont US-0333)
24 Tracks; 73:28; mit Infos
Von einer schwierigen und oft verleugneten Liebe handeln die von dem Münchner
Journalisten Jonathan Fischer auf „Dirty Laundry“ zusammengestellten Stücke.
Die auf den ersten Blick so ungewöhnliche Verbindung von schwarzem Soul und
weißem Country hat eine lange Tradition. Country-Urvater A.P. Carter hatte
viele Songs im Repertoire der Carter Family von dem Bluessänger Lesley
Riddle übernommen. Und auch Bluegrass-Erfinder Bill Monroe hatte sein
Handwerk u.a. von schwarzen Musikern gelernt. Fischer zitiert den
Folkloristen Norm Cohen, nach dem erst die afrikanische Beimischung Country
im Unterschied zu anderer ländlicher Musik aus den USA seinen weltweiten
Appeal verschafft habe. Soul-Größen wie James Brown oder Curtis Mayfield,
von dem der Titelsong des Samplers stammt, haben sich den Cowboyhut ebenso
aufgesetzt wie weitere prominente Namen, die hier die Seele der schwarzen
Countrymusik präsentieren - „The Soul Of Black Country“, so der Untertitel
der CD. Darunter Bobby Womack, Etta James, Johnny Adams, Solomon Burke und
die Pointers Sisters, die 1974 sogar einen Country Grammy gewannen und nach
Nashville eingeladen wurden. Dirty Laundry bietet jedoch nicht nur
akustisches Anschauungsmaterial zum Thema weiße und schwarze Musik. Das
umfangreiche Booklet untersucht auch seine gesellschaftlichen und
politischen Aspekte. „Mehr gut klingende Schmutzwäsche, bitte!“ kann ich da
nur mit dem Kritiker der Frankfurter Rundschau sagen.
Michael Kleff
| 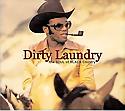
|
|
PAUL RISHELL & ANNIE RAINES
Goin’ Home
Artemis Records/Rykodisc/Rough Trade RCD17306
13 Tracks, 51:26, mit engl. Infos
Der Sänger und Gitarrist Paul Rishell ist mit seiner Frau Annie Raines sowohl
im akustischen wie auch im elektrischen Blues zu Hause. Zusammen sind sie seit
vielen Jahren ein außergewöhnliches Paar zwischen Country-, Pre-War- und
Rock-Blues. Ein Schubladendenken ist bei diesen Musikern ausgeschlossen. Sie
verstehen es, in beiden Genres zu überzeugen. Annie Raines spielt gefühlvoll
verschiedene Mundharmonikas und steht auch als Sängerin nicht im Schatten
ihres Mannes. Paul Rishell beweist mit 54 Jahren und kontinuierlicher Arbeit
in Sachen Blues auch die nötige Reife für alle Blue Notes. Begleitet werden
sie bei einigen Titeln von sieben verschiedenen Musikern und zwei
Background-Sängern für den Gospelpart. Eine davon ist die Tochter Vanessa.
Neben neu arrangierten akustischen Charley-Patton-Nummern mit
Resonator-Gitarre sind auch Songs mit elektrischer Gitarre und fettem
Band-Sound zu hören. Stilistisch ist die CD, die eine Live-Aufnahme und zwei
Eigenkompositionen umfasst, zwischen Blind Boy Fuller und Ma Rainey
angesiedelt. Unterschiedliche Blasinstrumente bringen Schwung und Lebendigkeit
in die gelungene Produktion des Duos mit überdurchschnittlichem Talent und
Engagement.
Annie Sauerwein
| 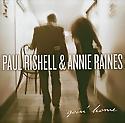
|
|
THE KLEZMATICS with Joshua Nelson & Kathryn Farmer
Brother Moses Smote the Water (live in Berlin)
(Piranha CD-PIR 1896/Indigo)
10 Tracks, 57:33, mit Infos
Seit fast zwanzig Jahren sind die Klezmatics einer der weltweit führenden
Gruppen ihres Genres und in hohem Maße mitverantwortlich für das immer noch
anhaltende Klezmerrevival. So spielen sie nicht nur mit Größen anderer
Musiksparten wie Arlo Guthrie (vgl. die Rubrik „Szene“ dieses Heftes), sondern
etwa auch als Hochzeitskapelle in einer Folge von „Sex and the City“. Für ihr
erstes, am 31. Juli 2004 in Berlin aufgenommene Live-Album hat sich die Gruppe
nun mit folgenden zwei beachtenswerten Musikern zusammengetan: Mit dem
farbigen, zum Judentum konvertierten, hebräisch und englisch singenden
Gospelsänger Joshua Nelson sowie mit Kathryn Farmer (beide Gesang, Piano). Es
sollte ein Dialog der Kulturen und verschiedener Musikrichtungen entstehen,
indem Elemente aus dem jüdischen wie dem afroamerikanischen Erbe gemeinsam
„erarbeitet“ werden. So wechseln sich ganz konsequent eher traditionell
jüdische Lieder (etwa „Eyliyohu Hanovi“) mit kräftigen Gospelweisen (wie z.B.
„Elijah Rock“) ab. Nicht fehlen durfte außerdem das populärste Stück der
Klezmatics, nämlich „Shnirele Perele“, neuerdings mit leicht geändertem Text
gegenüber der Urfassung von 1990 (u.a. sollen nun „alle Völker“ friedlich in
Israel zusammenleben). Vermisst werden die Texte zu den Liedern, wenngleich
das Beiheft ansonsten jedes einzelne Lied umfassend mit anderweitigen Infos
belegt.
Matti Goldschmidt
| 
|
|
JIM CROCE
The Way We Used To Be/The Anthology
(Sanctuary Records SMETD117)
Dreifach-CD, 65 Tracks, 195:00, mit Infos
Als Jim Croce am 20. September 1973 bei einem Flugzeugabsturz im Alter von 30
Jahren ums Leben kam, hatte er mit „Bad, Bad Leroy Brown“ gerade seinen ersten
Nummer-1-Hit gehabt. Zwar hatte sich der in Philadelphia geborene
Italo-Amerikaner mit der an Gordon Lightfoot erinnernden Stimme in den zwei
Jahren vor seinem Tod bereits einen Namen in der Szene gemacht. Doch der Ruhm
kam erst posthum. Als Jugendlicher hatte Croce 50er-Jahre-Hits sowie Stücke
von Bessie Smith, Jimmy Rodgers oder Cisco Houston vorgetragen. Mit dem
College-Folk-Quartett The Spires nahm er 1963 seine erste Platte auf.
Versuche, Mitte der sechziger Jahre mit seiner schwedischen Frau Ingrid
Jacobsen in der Folk-Metropole New York als Duo Fuß zu fassen, scheiterten.
Der Erfolg stellte sich erst ein, als er einen eigenen Stil fand, der sich von
seinen Vorbildern Lightfoot, Tom Rush oder Ian & Sylvia unterschied. 1971
entstand mit dem Gitarristen Maury Muehleisen die LP „You Don´t Mess Around
With Jim“. Zwei Jahre später erschien das Nachfolgealbum „Life & Times“.
Beide zeugen von Croces Öffnung für neue Stilrichtungen und seiner Fähigkeit,
humorvolle wie trockene Geschichten und Charakterstudien zu präsentieren. Die
Anthologie enthält die beiden LPs ebenso wie das posthum erschienene Album „I
Got A Name“ mit dem gleichnamigen Single-Hit sowie Live-Aufnahmen („Live - The
Final Tour“) und die 1975 veröffentlichte Doppel-LP „The Faces I´ve Been“ mit
unveröffentlichten Songs und Demos für Fernsehprojekte.
Michael Kleff
| 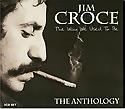
|
|
DAVE VAN RONK
... And The Tin Pan Bended, And The Story Ended ...
(Smithsonian/Folkways/Sunny Moon SFW CD 40156)
24 Tracks, 78:59, mit Infos
Man hat ihn einen Folkmusiker genannt, dabei wollte er immer ein Jazzsänger
sein: Dave Van Ronk. Vor fast genau zwei Jahren starb Van Ronk an Krebs. Die
vorliegende CD dokumentiert sein letztes Konzert im Oktober 2001. Dem
Gitarristen und Sänger ist nicht anzuhören, dass er wenige Tage vorher eine
tödliche Diagnose bekommen hatte. Dave Van Ronk steckte seine ganze Kraft in
seinen Auftritt, wie der Konzertmitschnitt mit Blues-, Jazz- und Folkstücken
u.a. von Jelly Roll Morton, Mississippi John Hurt, Bob Dylan und Joni Mitchell
eindrucksvoll belegt. Erfreulicherweise wurden auch Van Ronks Ansagen zwischen
den Songs nicht herausgeschnitten. Es war eine Show wie jede andere, schreibt
Van Ronks langjährige Lebenspartnerin Andrea Vuocolo im CD-Booklet: „And, as
usual, only one encore. Because, as Dave used to say, you should always leave
them wanting more.“ Zu einem weiteren Konzert ist es nicht mehr gekommen. Tom
Paxton beschreibt im Booklet ausführlich Leben und Karriere von Dave Van Ronk,
der eine Art Vaterrolle für die vor 40 Jahren in die Stadt strömenden jungen
Singer/Songwriter spielte und dafür den Ehrennamen „Bürgermeister der
MacDougal Street“ bekam. Im vergangenen Sommer wurde die Straße, in der er
gewohnt hatte, in „Dave Van Ronk Street“ umbenannt. Die einzelnen Songs werden
von dem Journalisten Elijah Wald in ihrer Geschichte und Bedeutung für den
Musiker kommentiert. Für Van Ronk-Freunde ein Muss, für alle, die ihn nicht
kennen, ein hervorragender Einstieg.
Michael Kleff
| 
|
|
ERIC ANDERSEN
The Street Was Always There/Great American Song Series Vol. 1
(Appleseed RecordingsAPR CD 1082)
14 Tracks, 63:29, mit Infos
„There was rebel music in the air.“ Mit dieser Zeile führt der Journalist
Glenn O´Brien in das Booklet der CD ein. Im Dezember 2003 aufgenommen, enthält
„The Street Was Always There“ eine von Robert Aaron produzierte Sammlung von
Songs, die Anfang der 60er Jahre in New Yorks Künstlerviertel geschrieben
wurden. Von Fred Neil, Tim Hardin, David Blue, Phil Ochs, Peter La Farge, Paul
Siebel, Patrick Sky, Buffy Sainte-Marie und Bob Dylan. Eric Andersen selbst
hat zwei Songs beigesteuert, darunter den Titelsong. Darin macht er, selbst
ein Village-Veteran, deutlich, dass die Straße den Menschen gehört, die dort
für ihre Rechte kämpfen. Mit Gastmusikern wie John Sebastian, Patrick Sky,
Happy Traum und dem HipHop-Star Wyclef Jean spielt Eric Andersen die alten
Songs nicht einfach nach, sondern verleiht ihnen ein eigenes musikalisches
Gewand. „The Street Was Always There“ ist nicht nur ein musikalisches
Dokument, das an die Jahre erinnert, in denen in Straßen wie MacDougal und
Bleecker eine neue amerikanische Musik geboren wurde: die
Singer/Songwriterszene. Die Texte der Songs belegen auch ihre zeitlose
Bedeutung im politischen Kampf für die Bürgerrechte, gegen Rassismus und gegen
den Krieg. Daran erinnern auch Andersen selbst und Produzent Aaron in ihren
informativen Bookletbeiträgen.
Michael Kleff
| 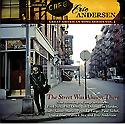
|